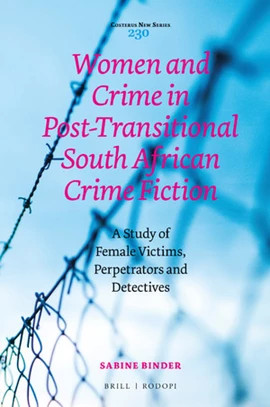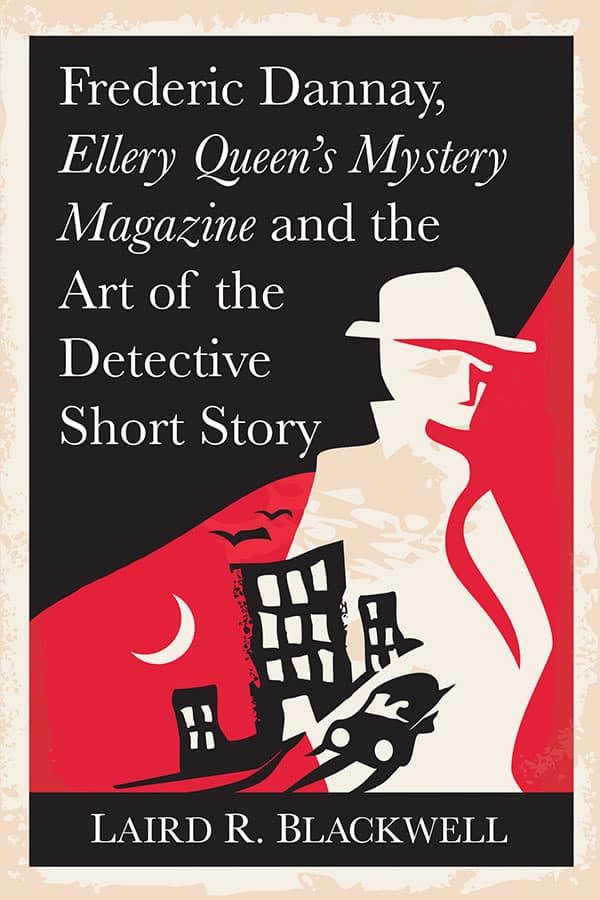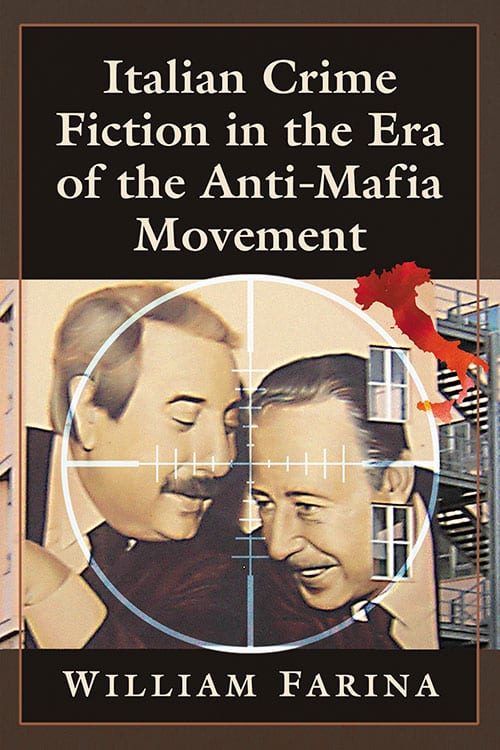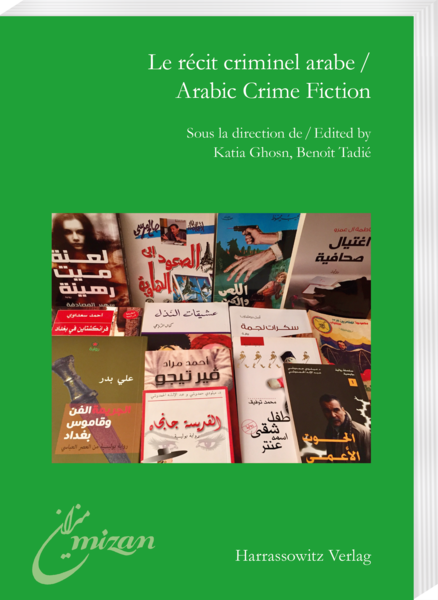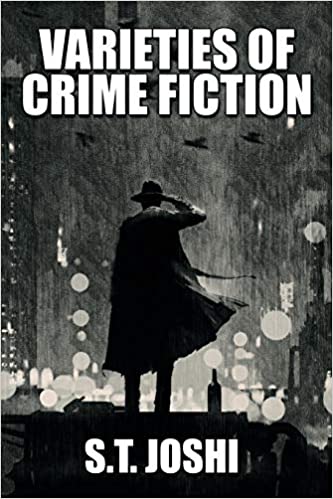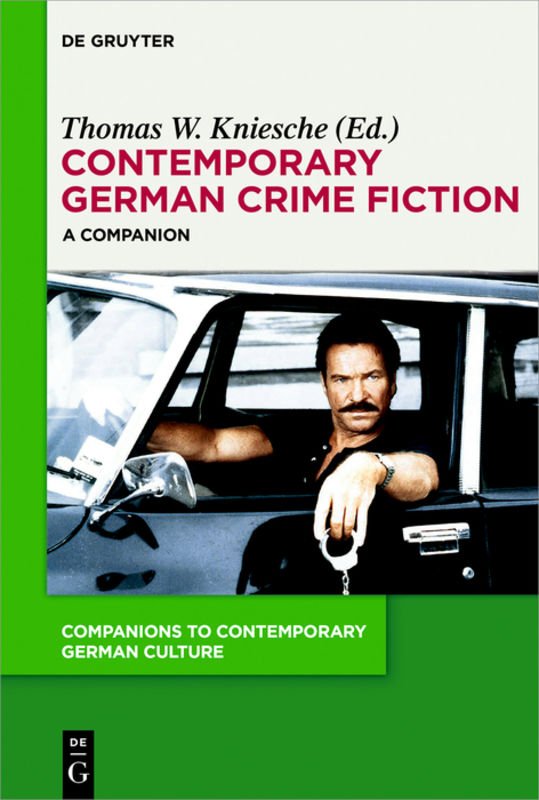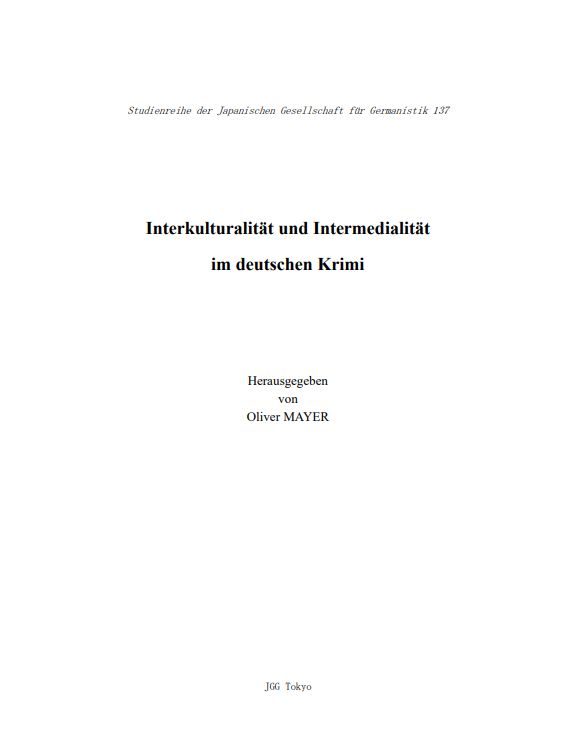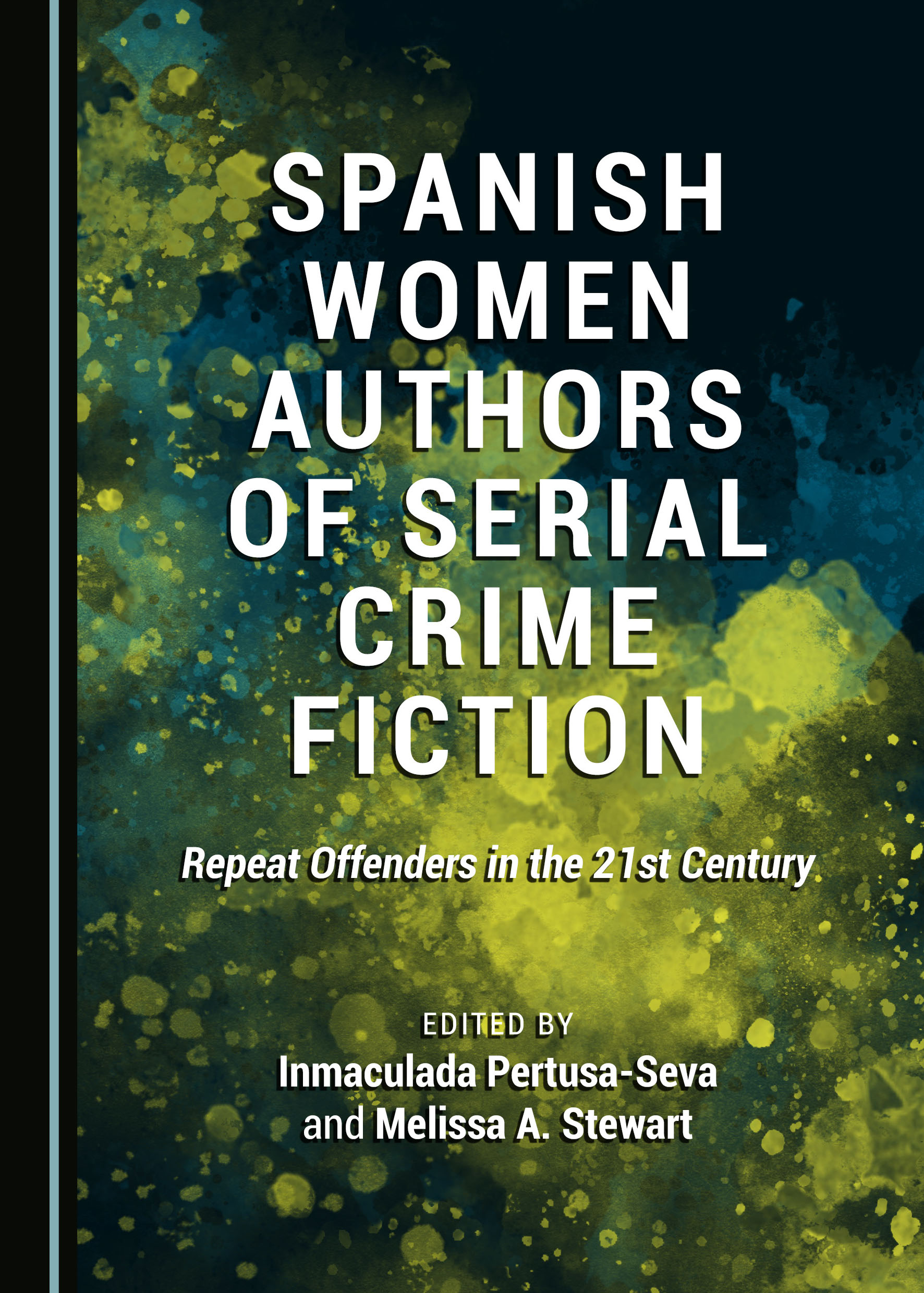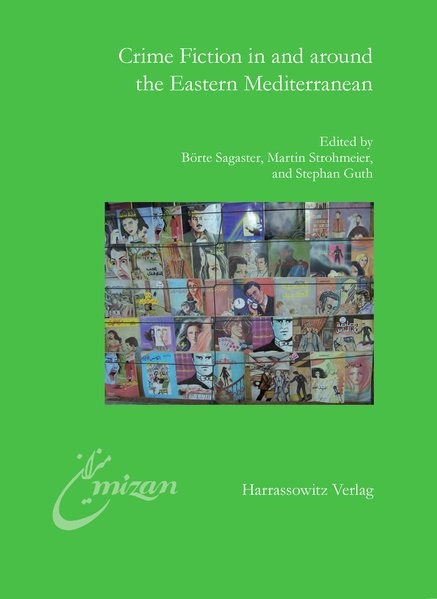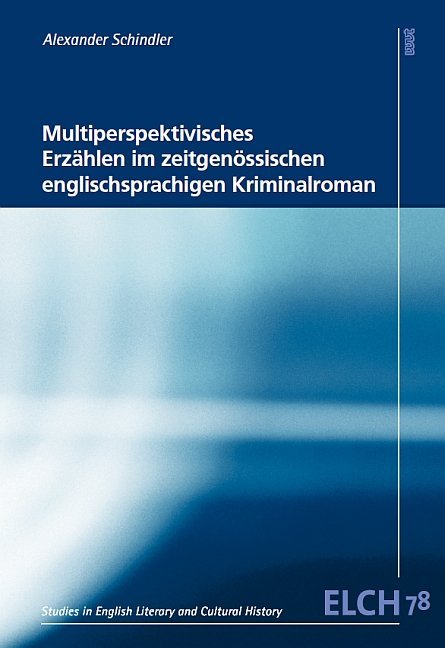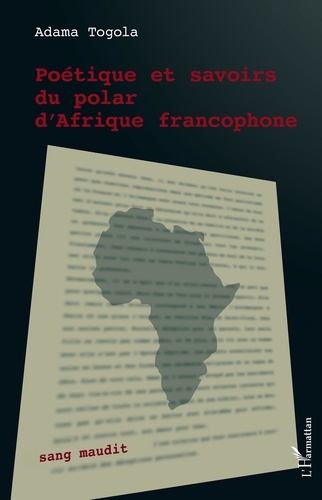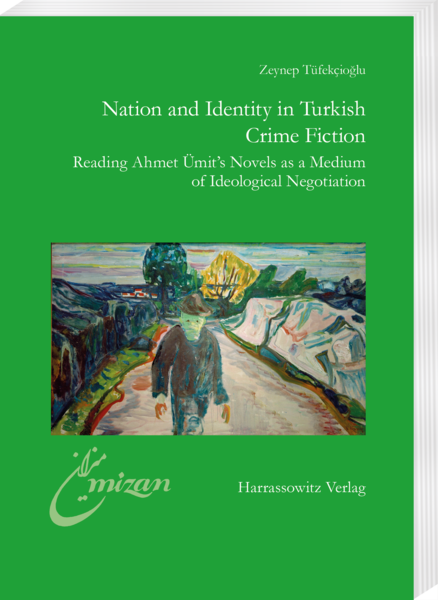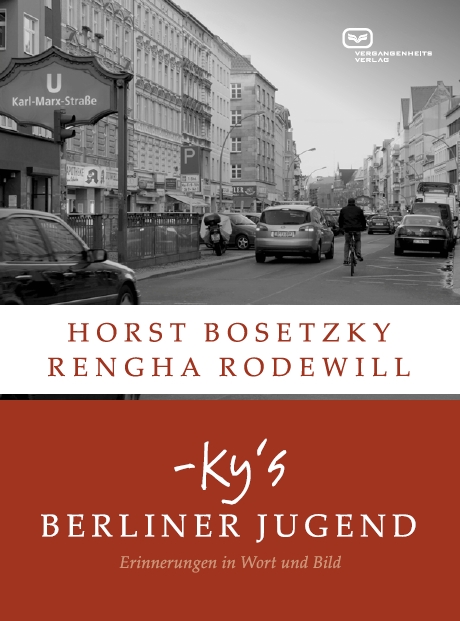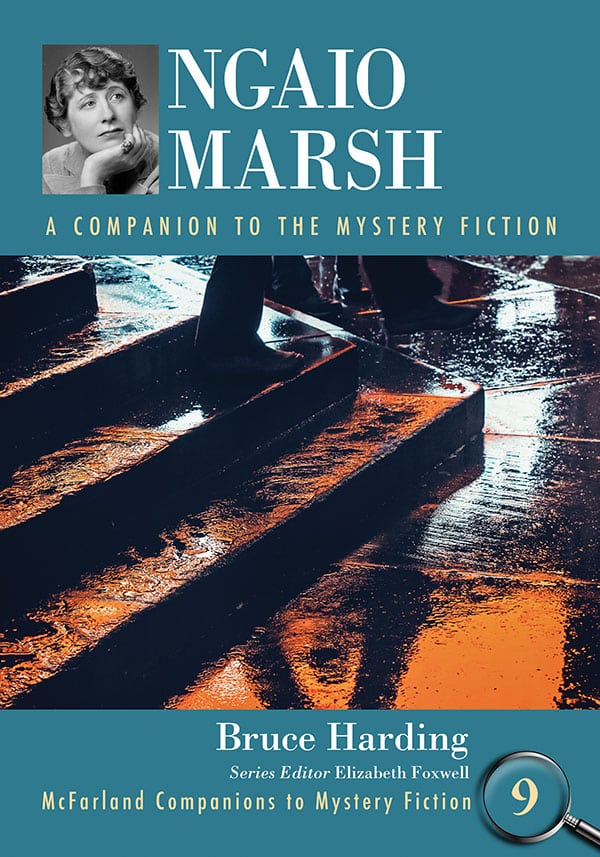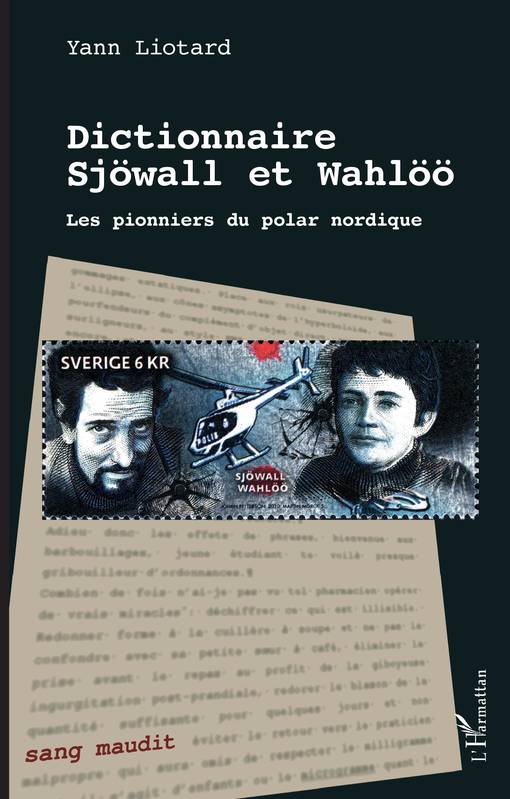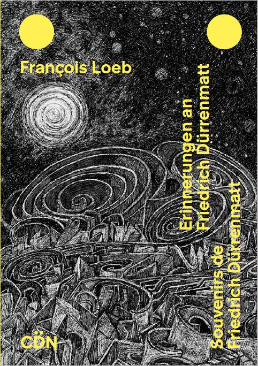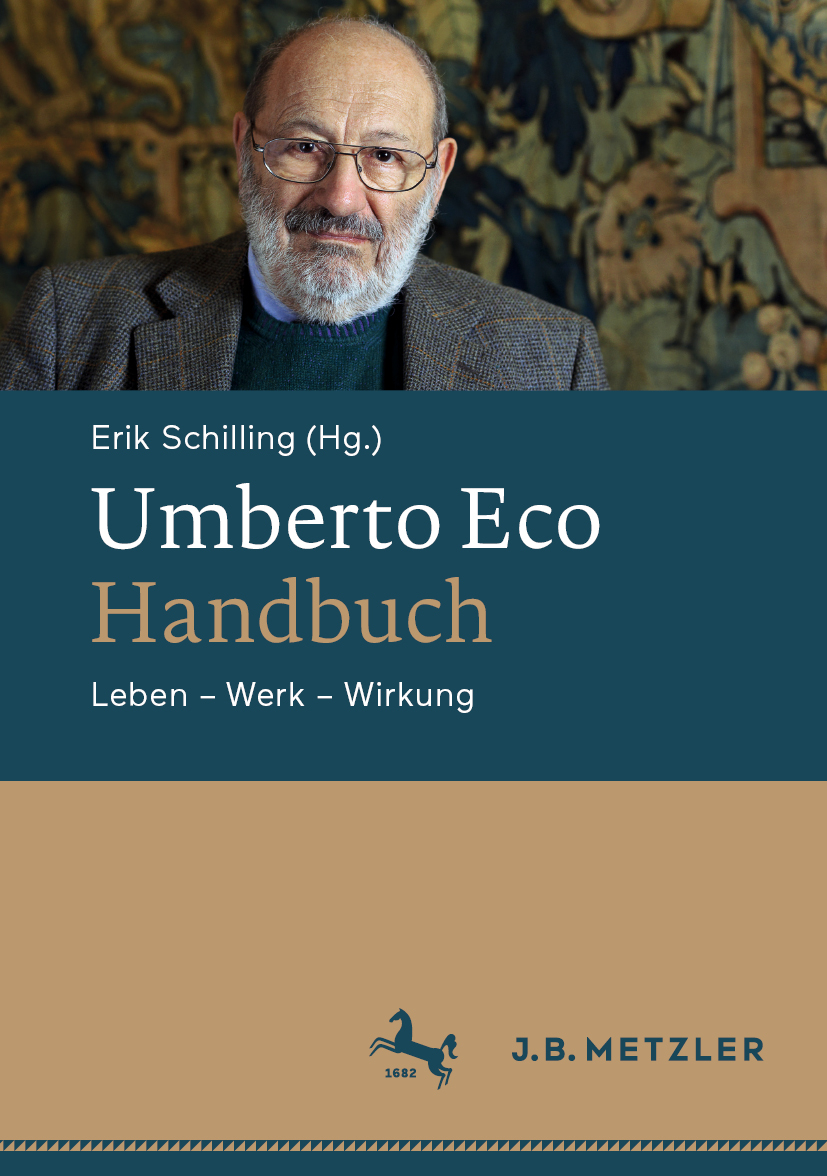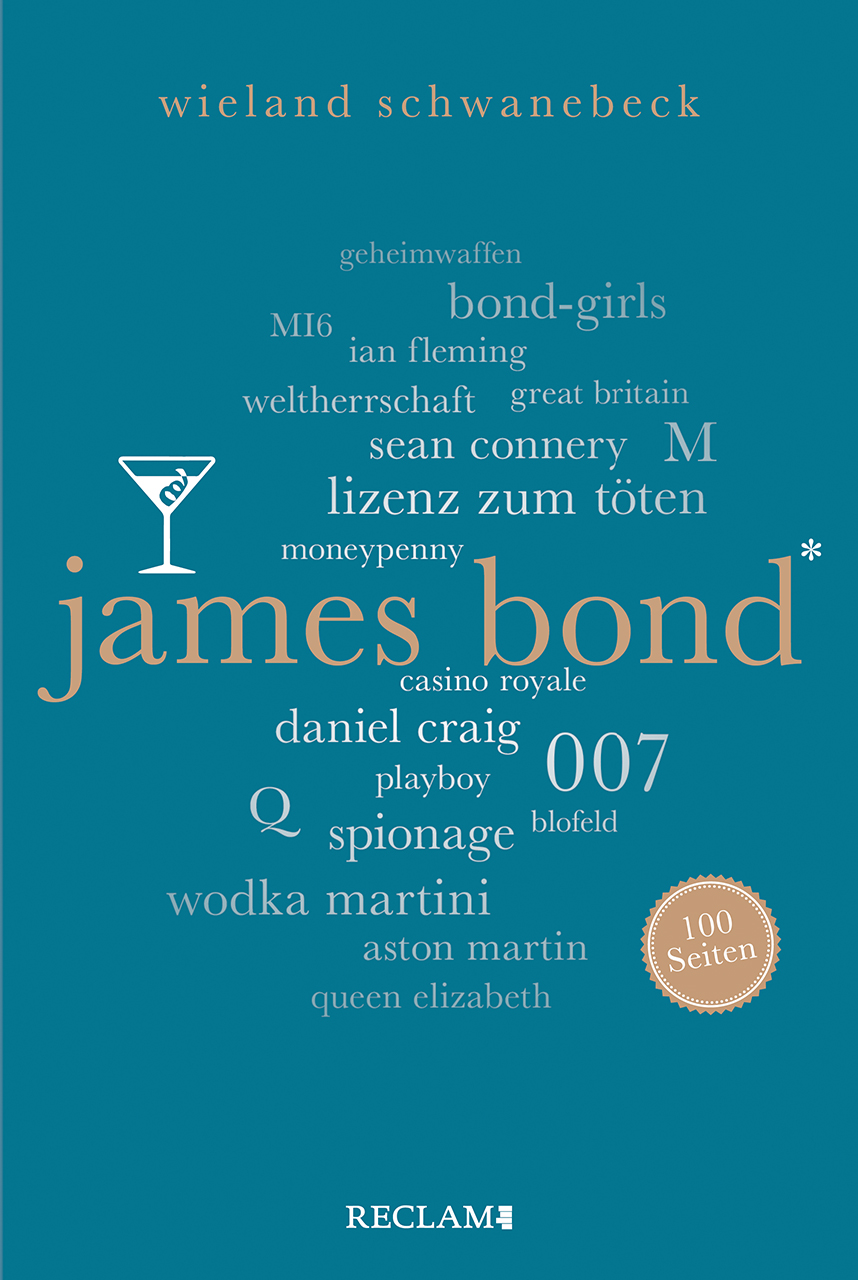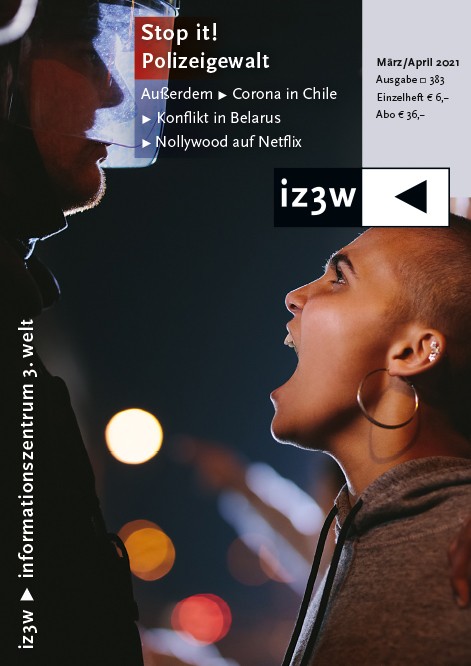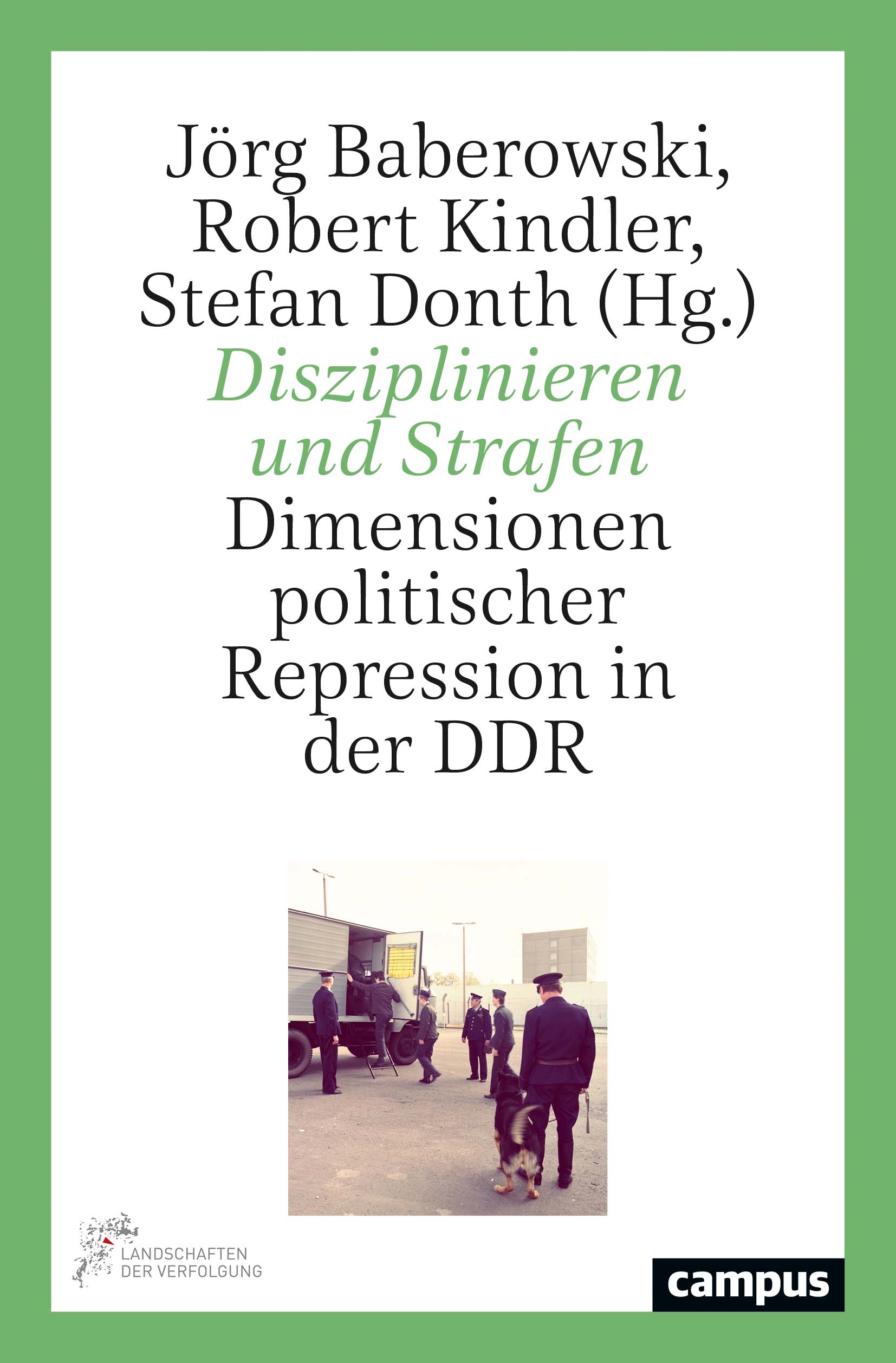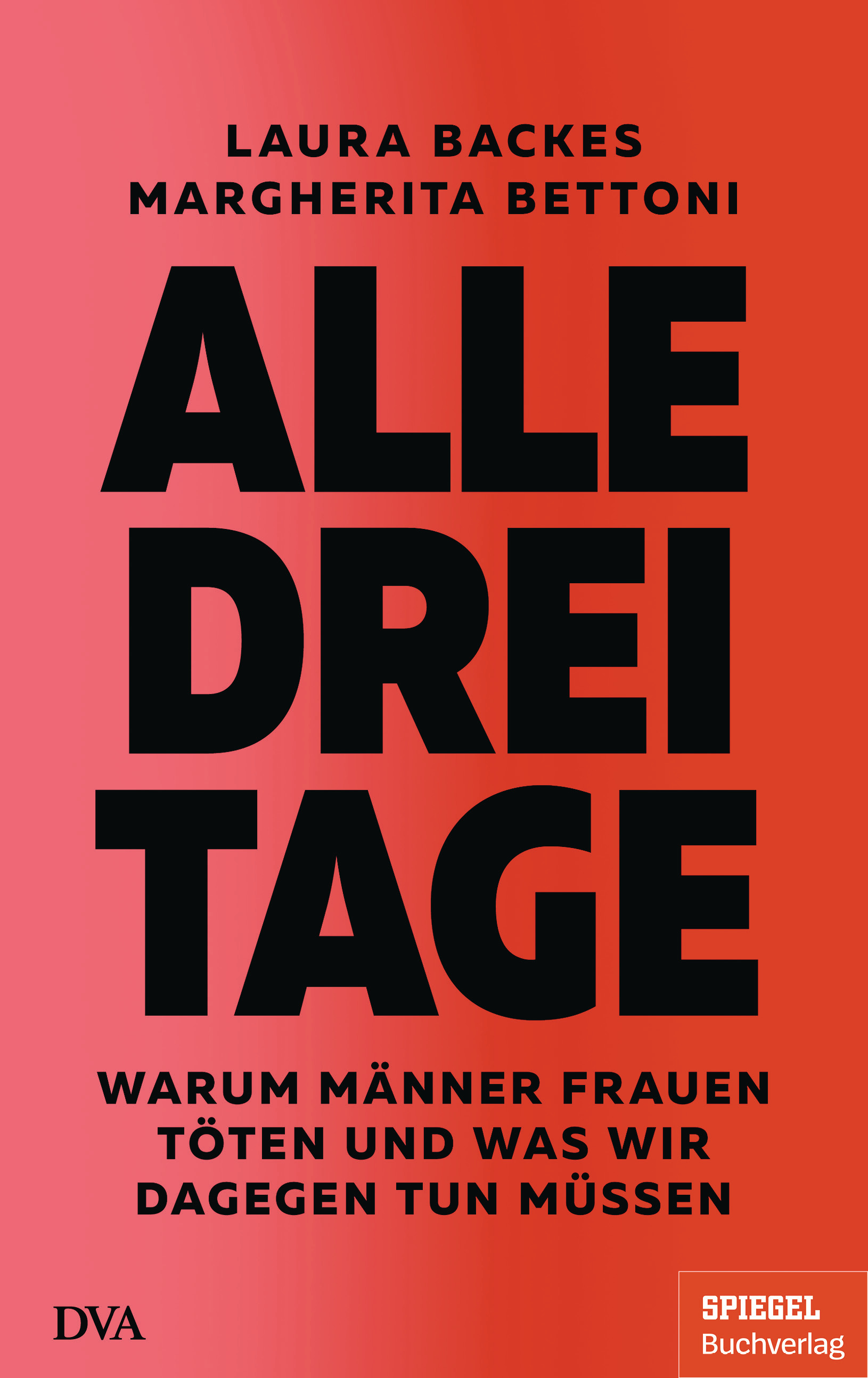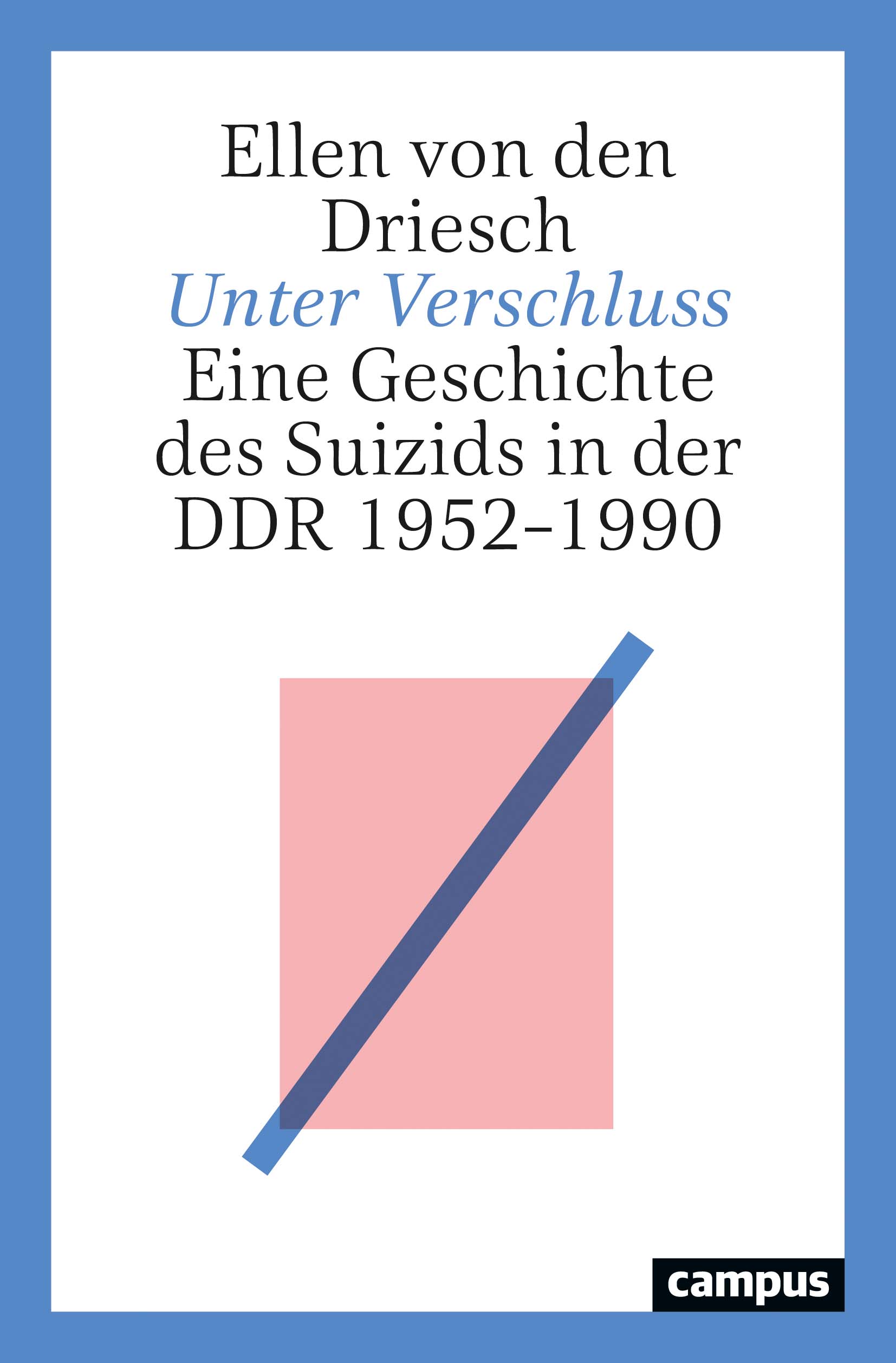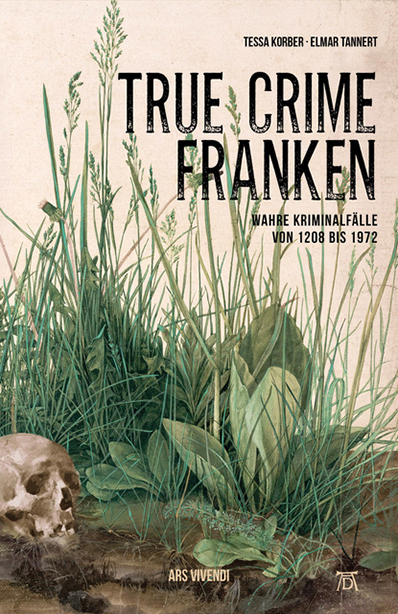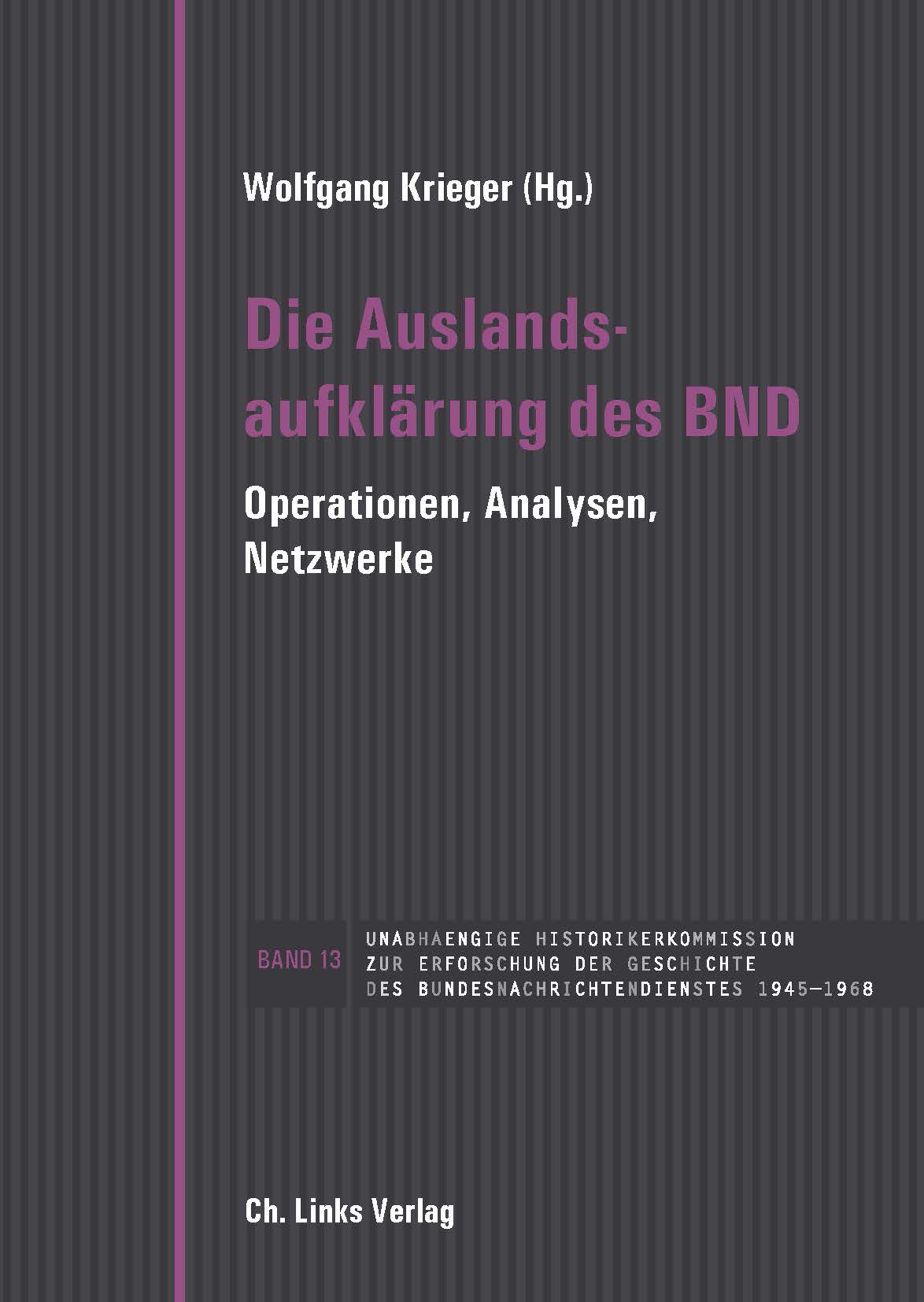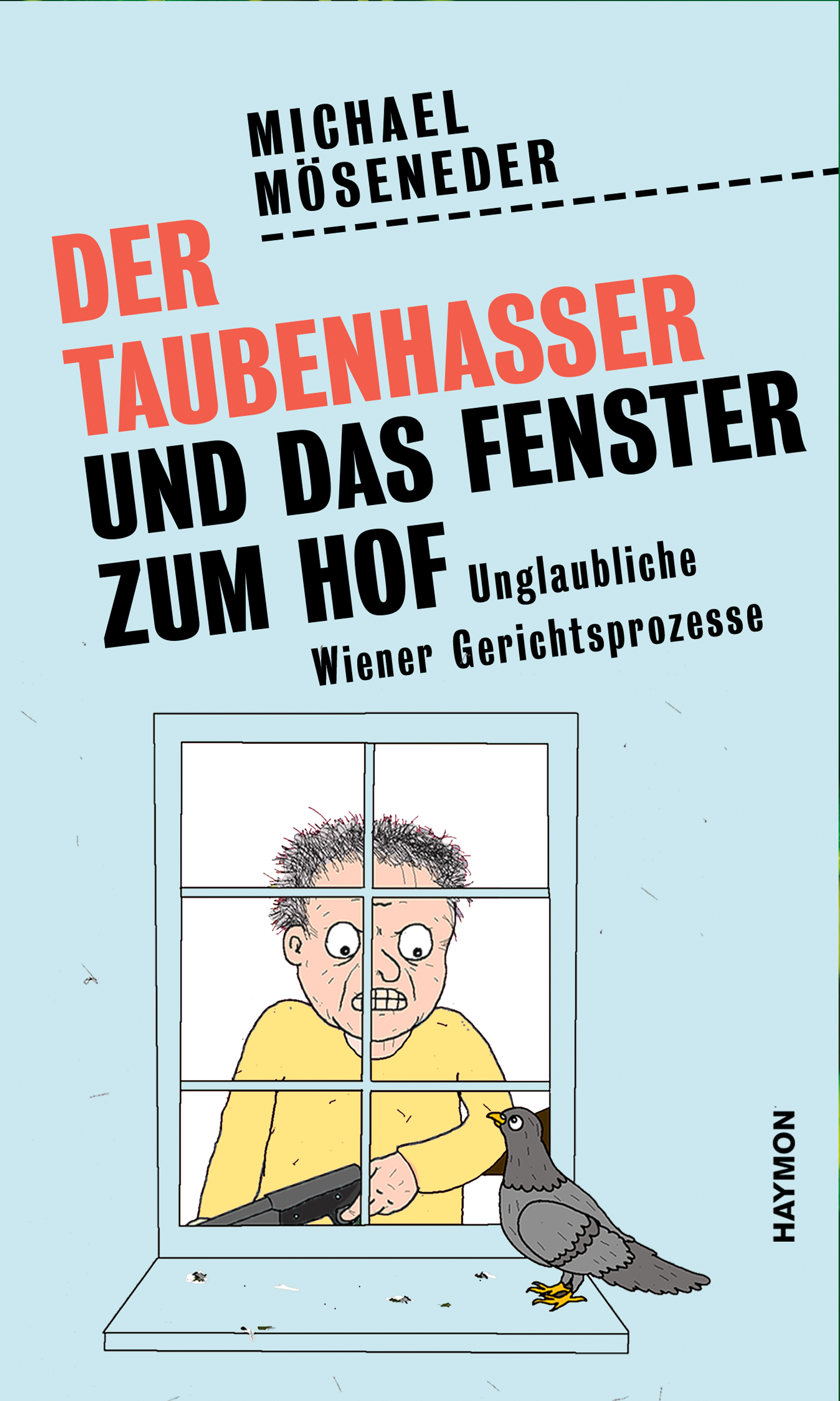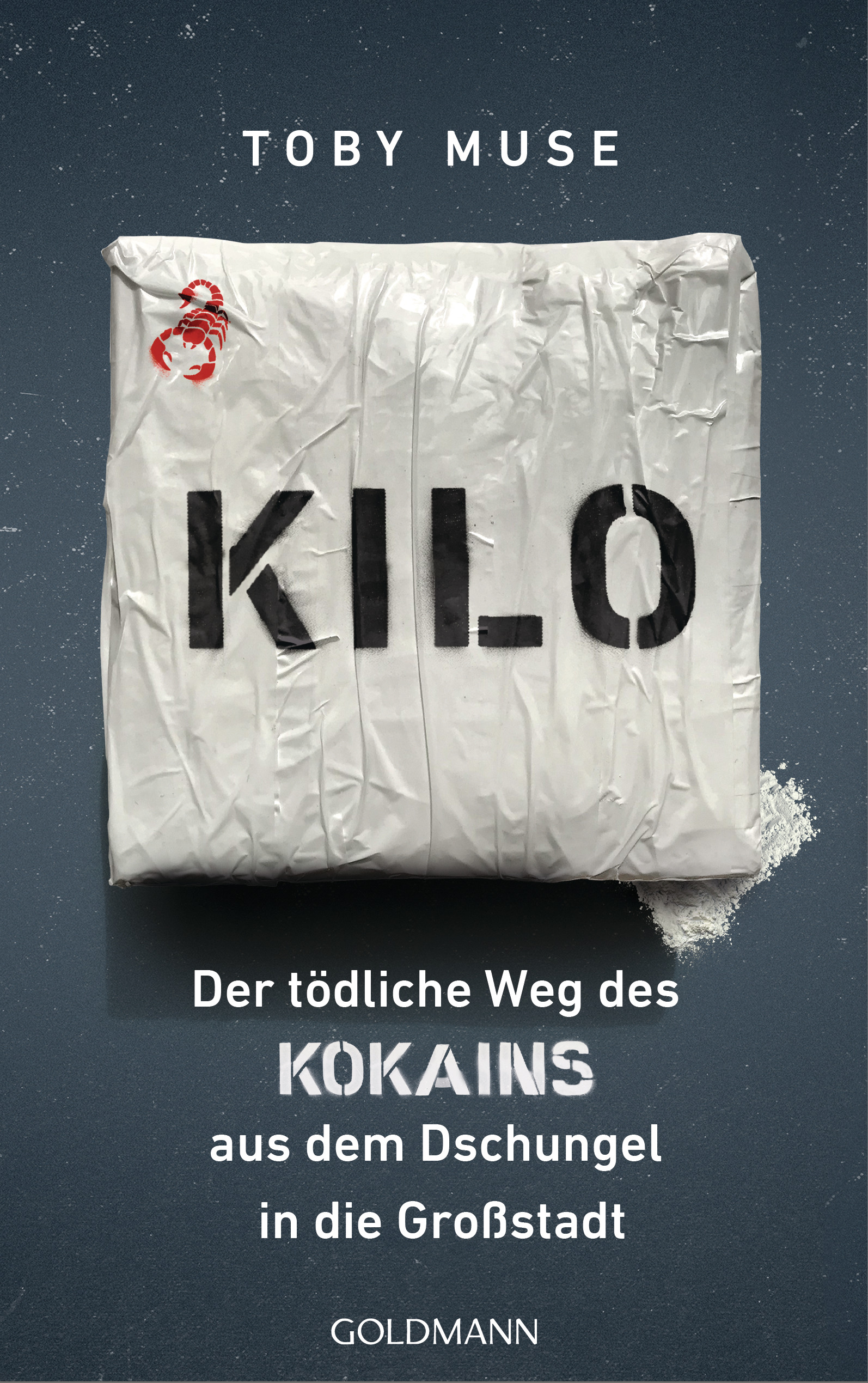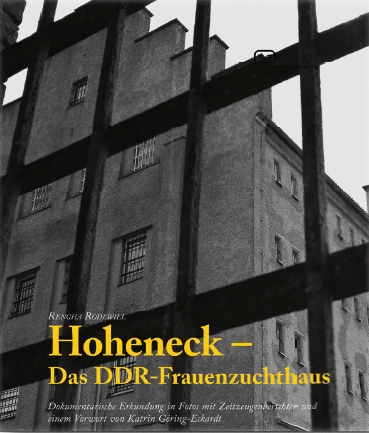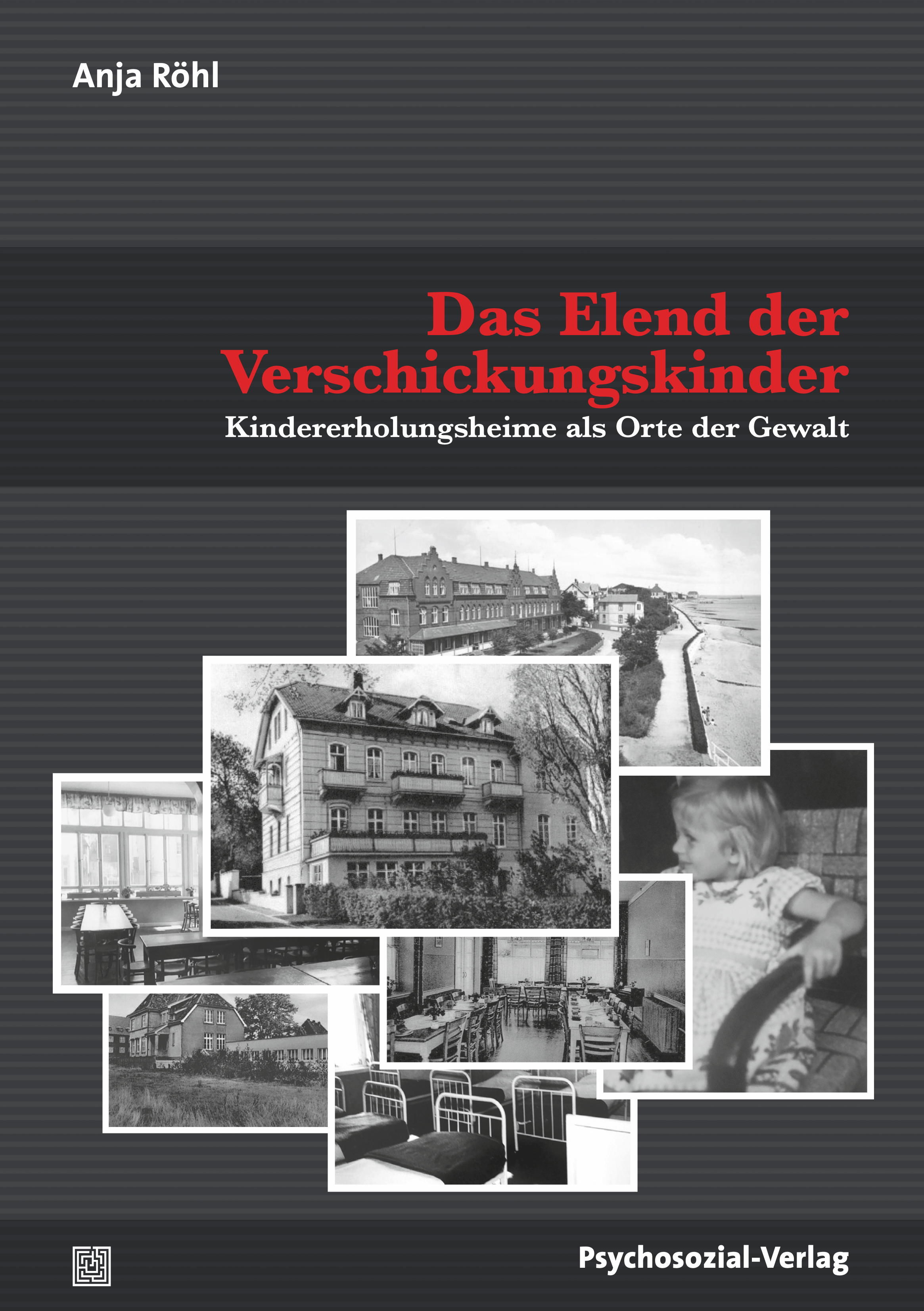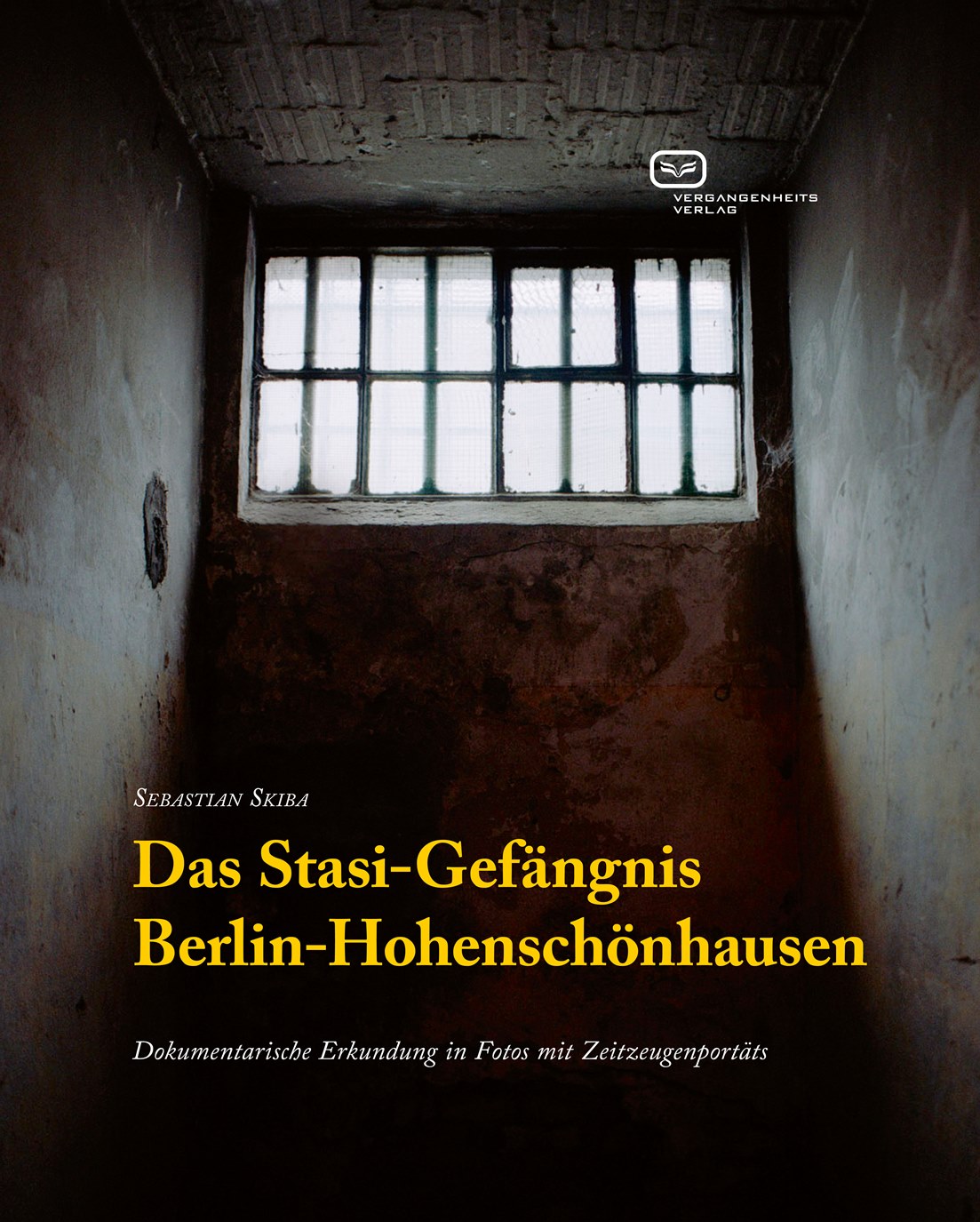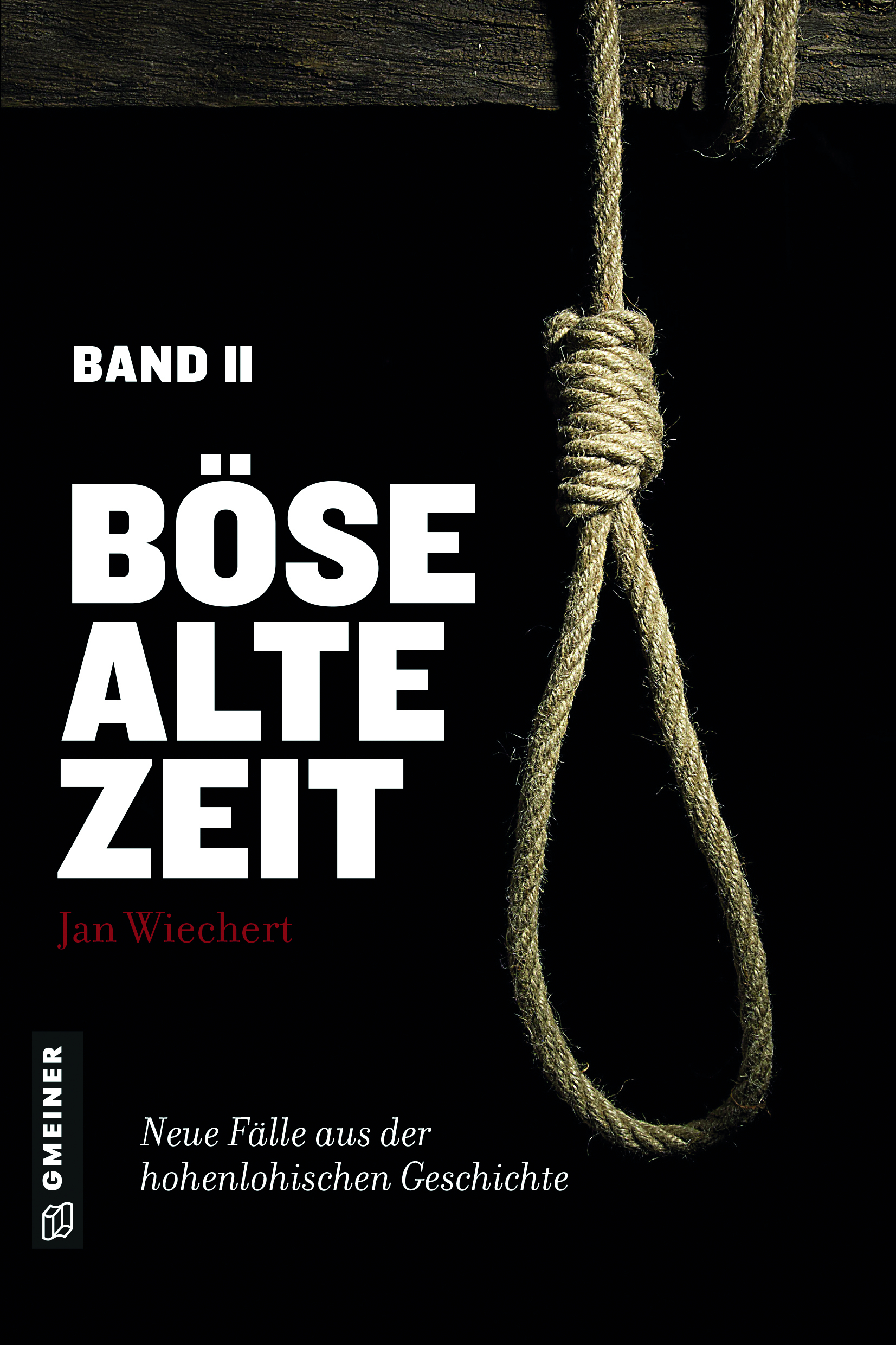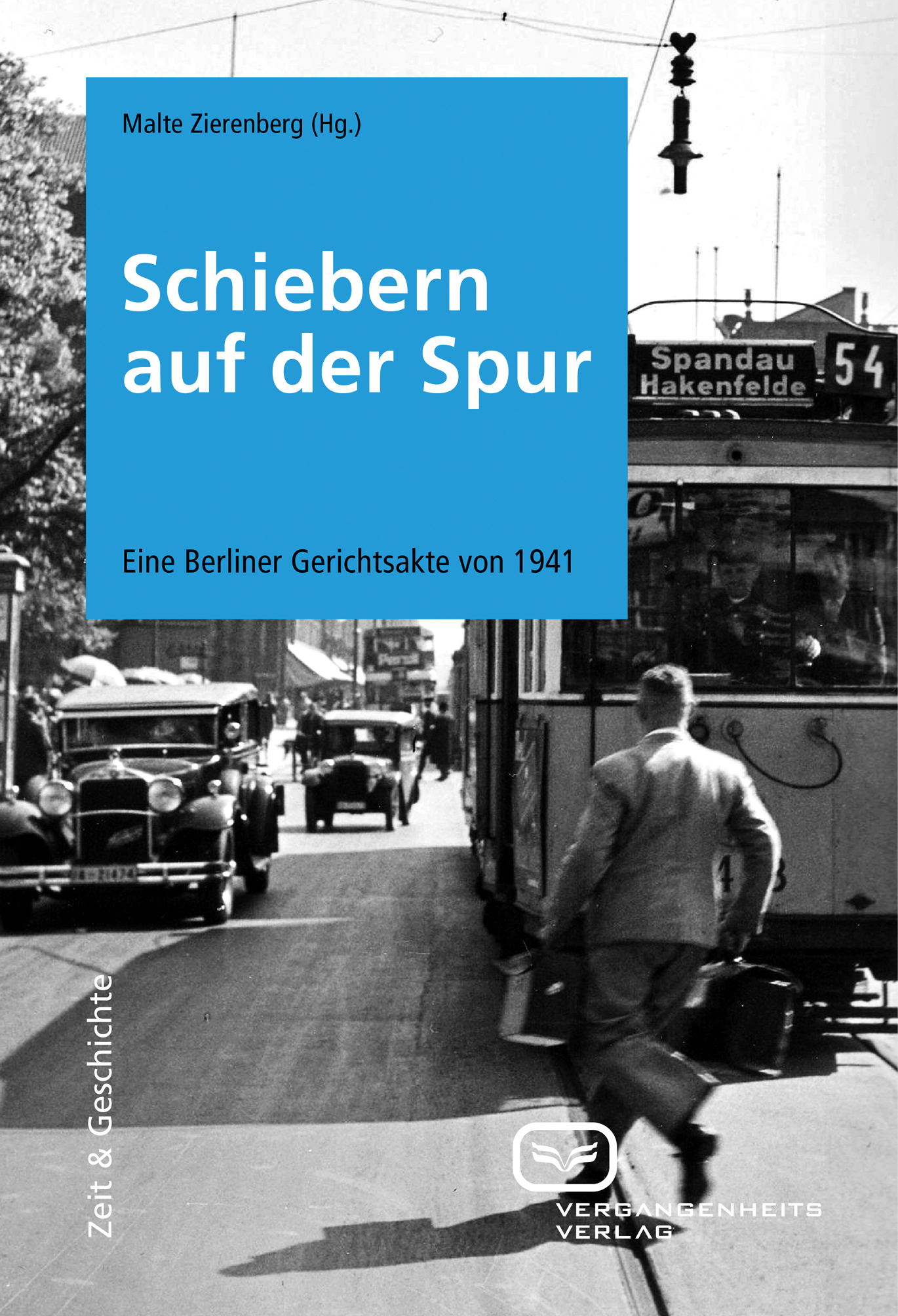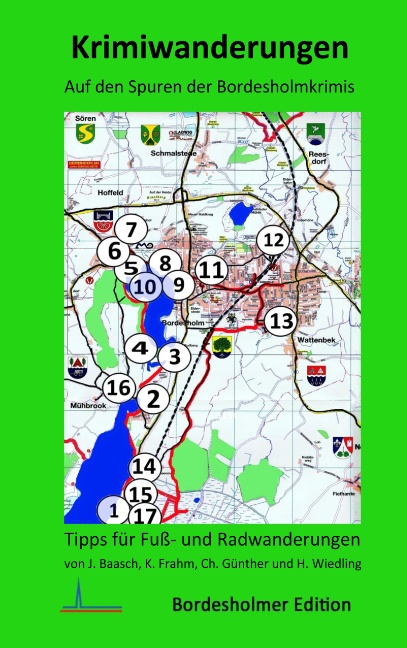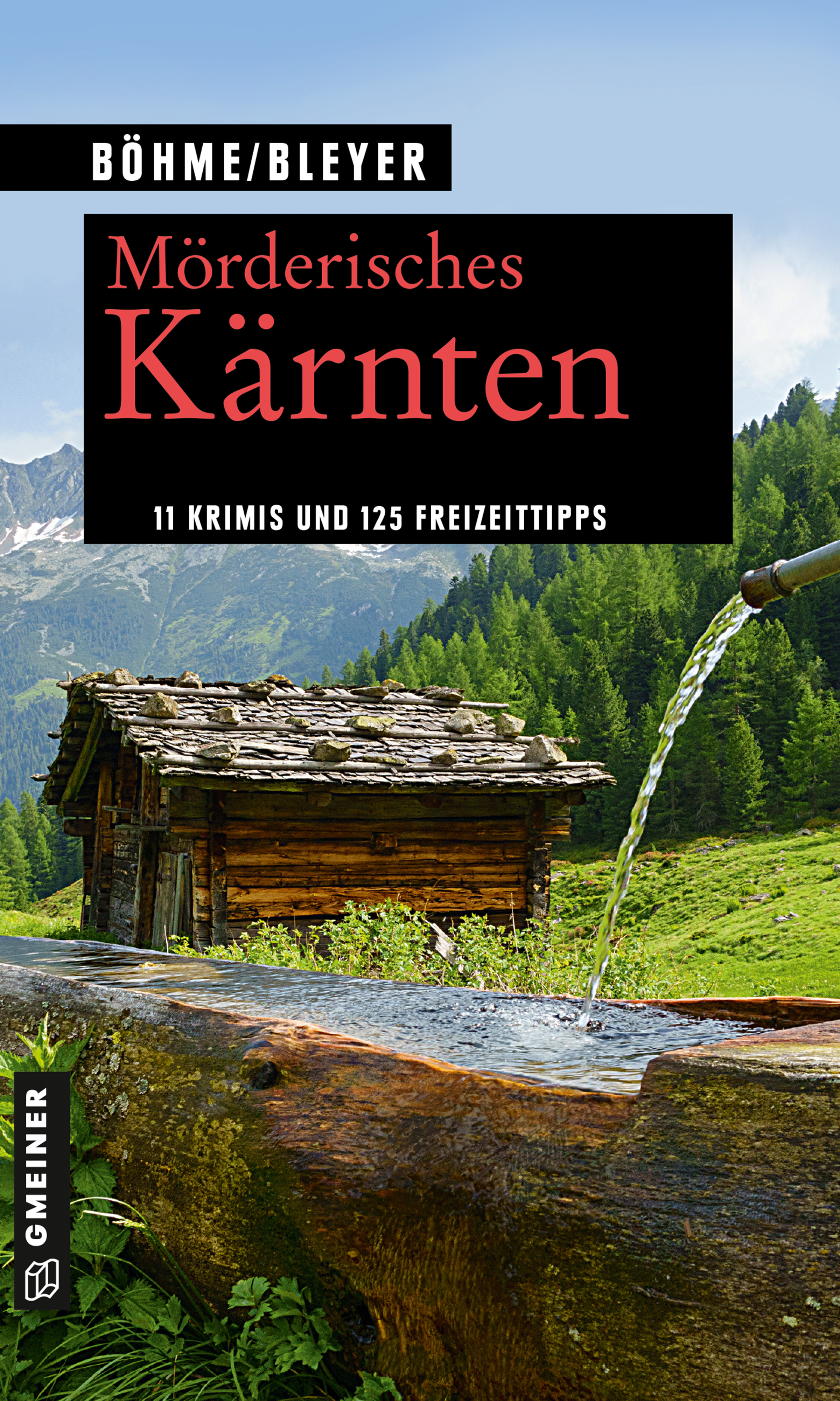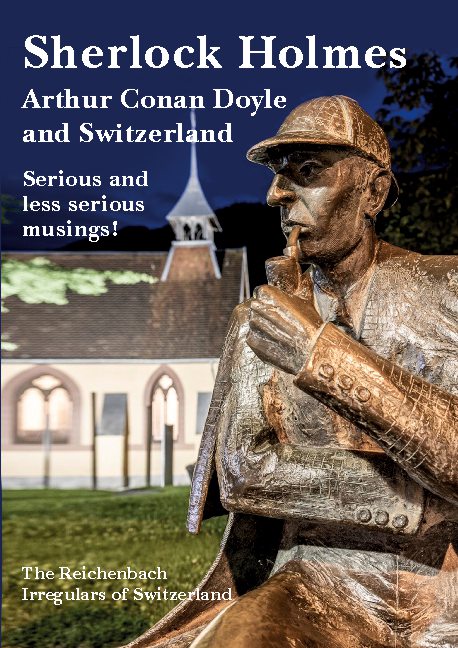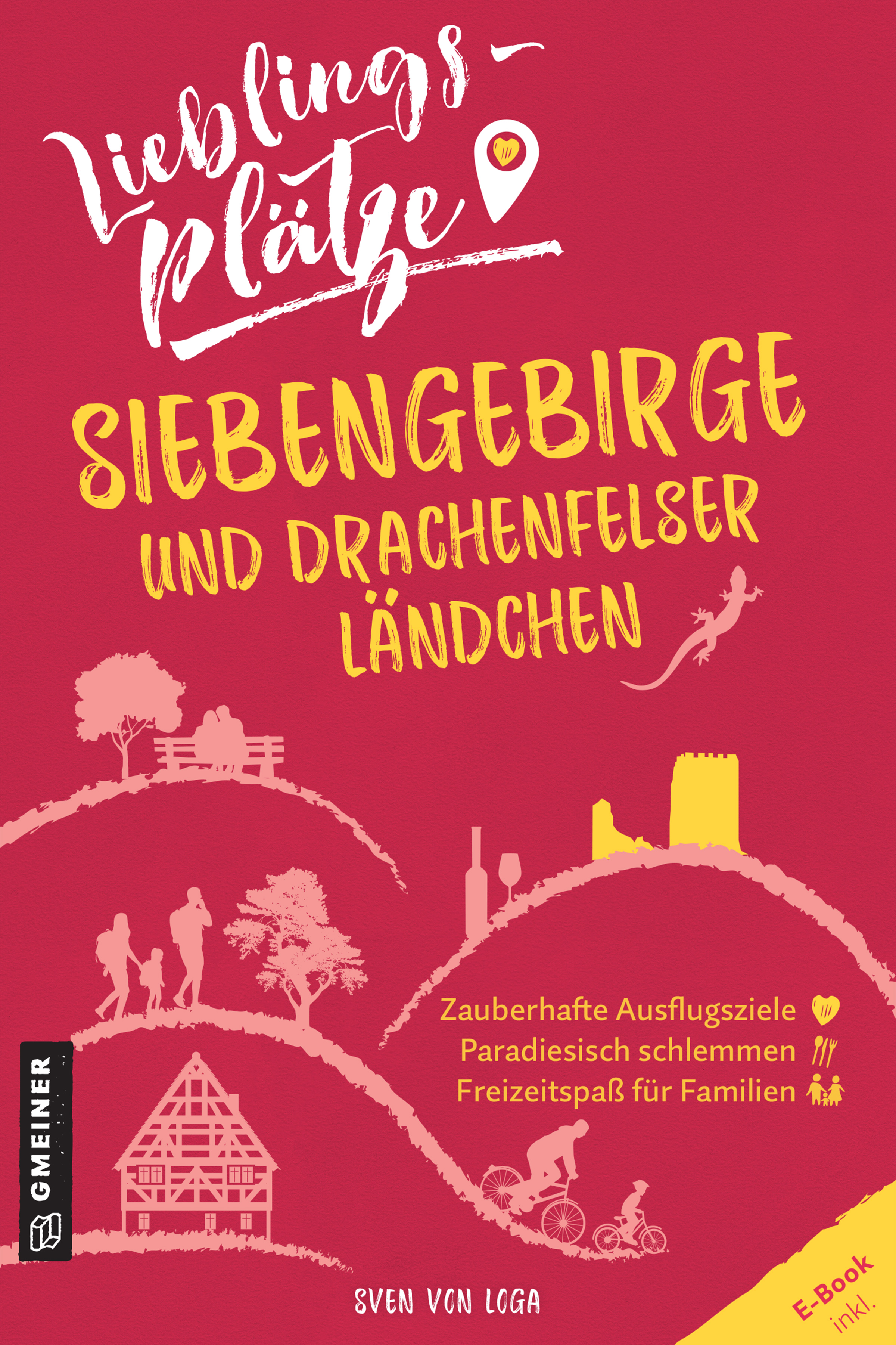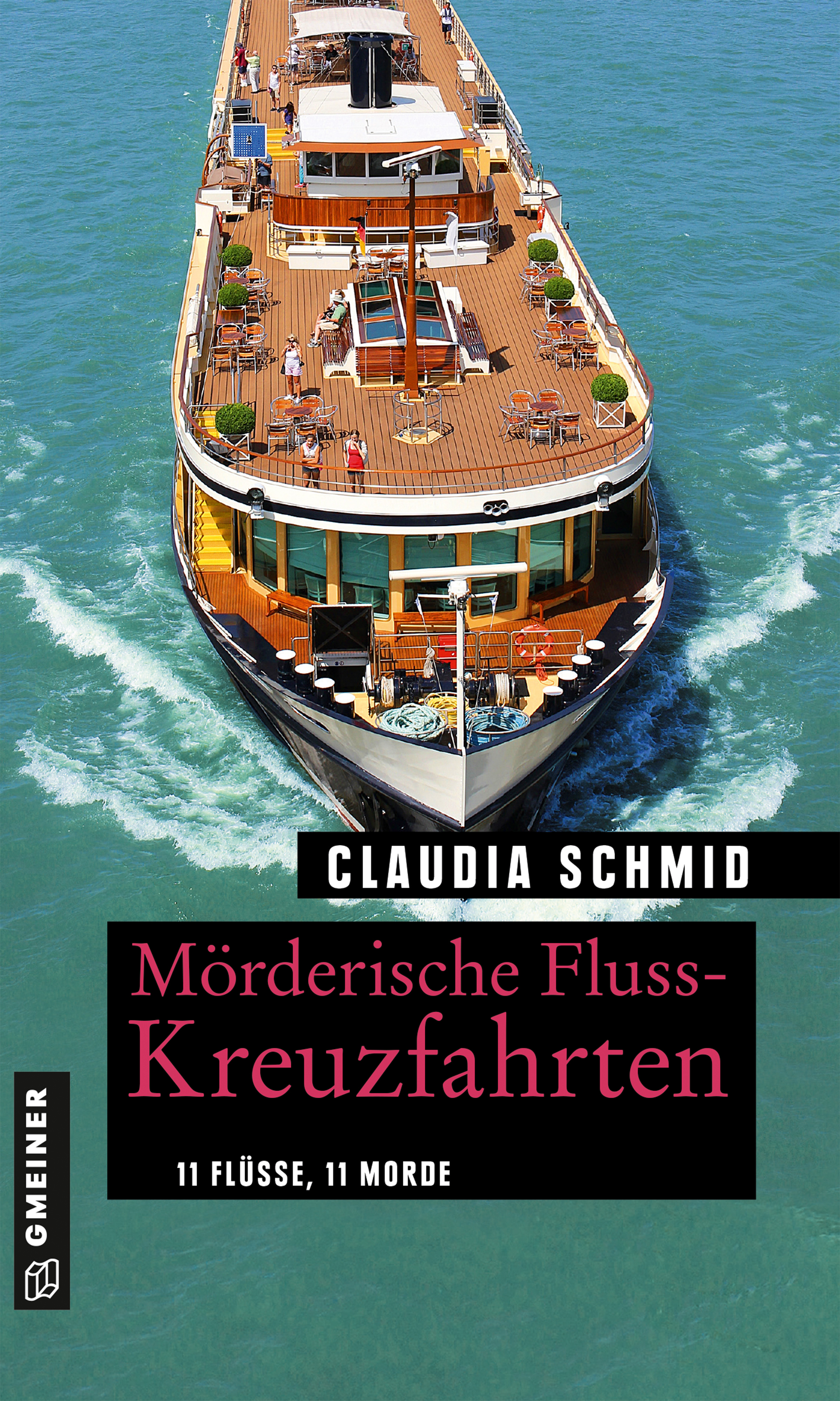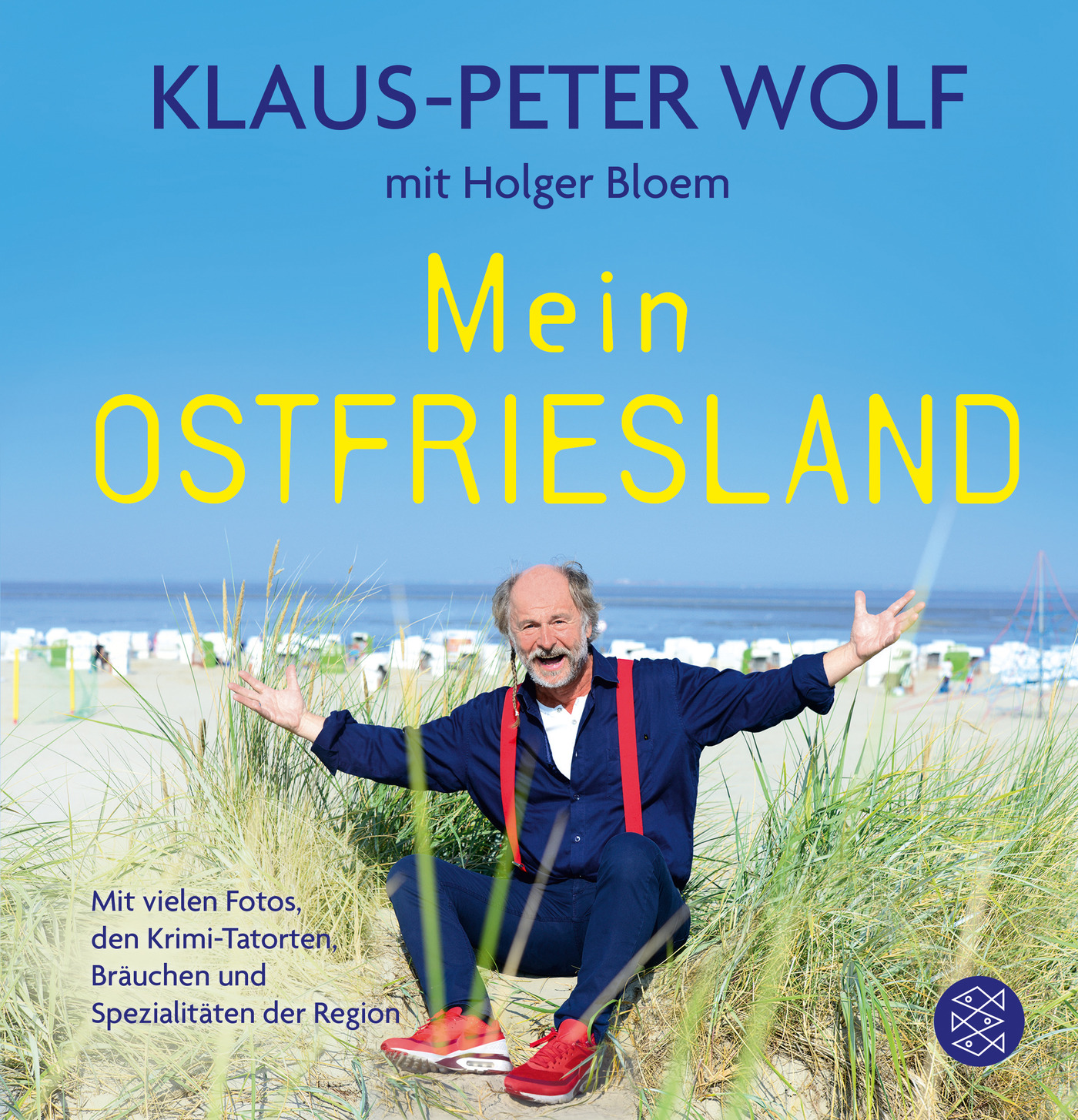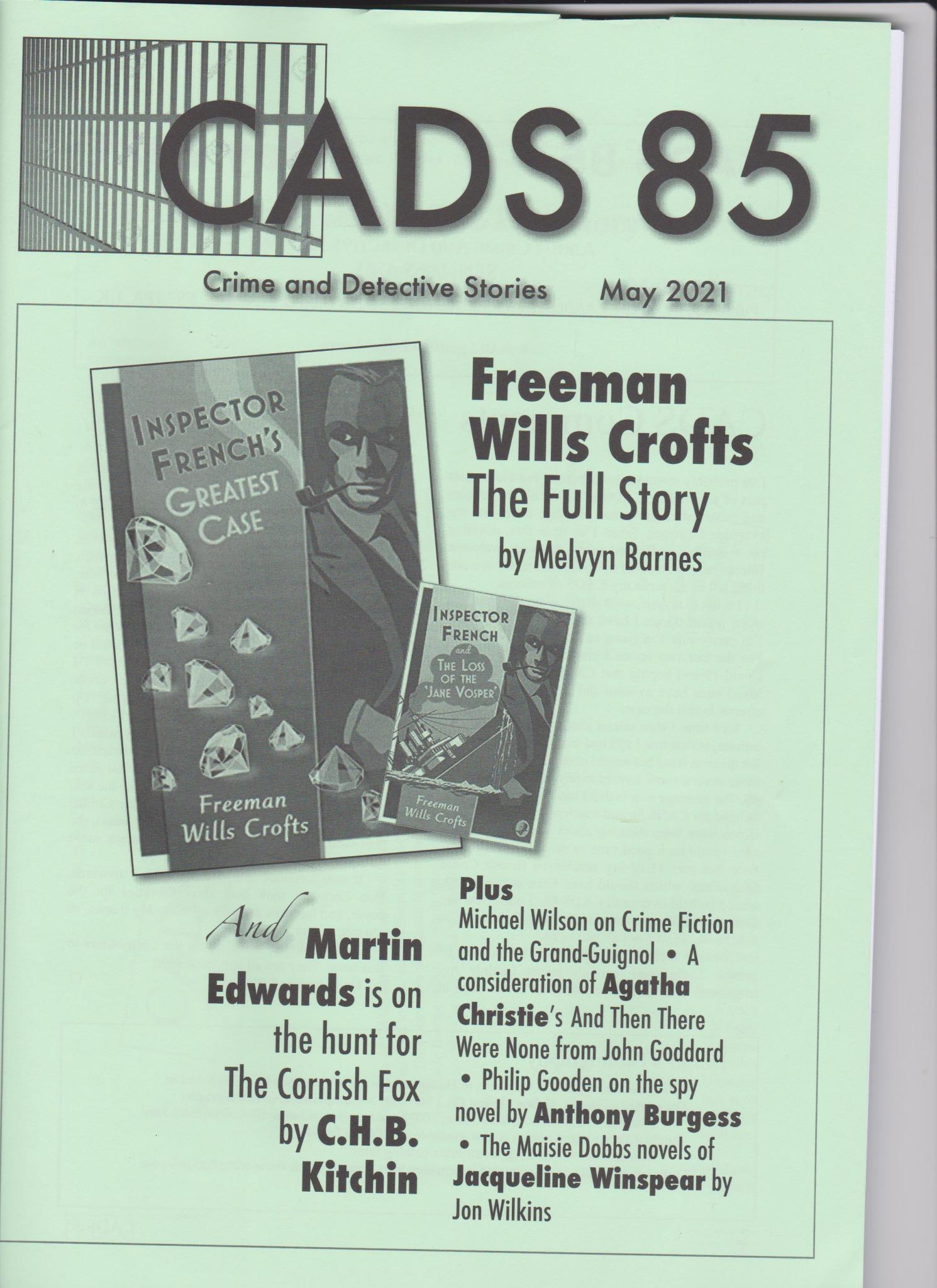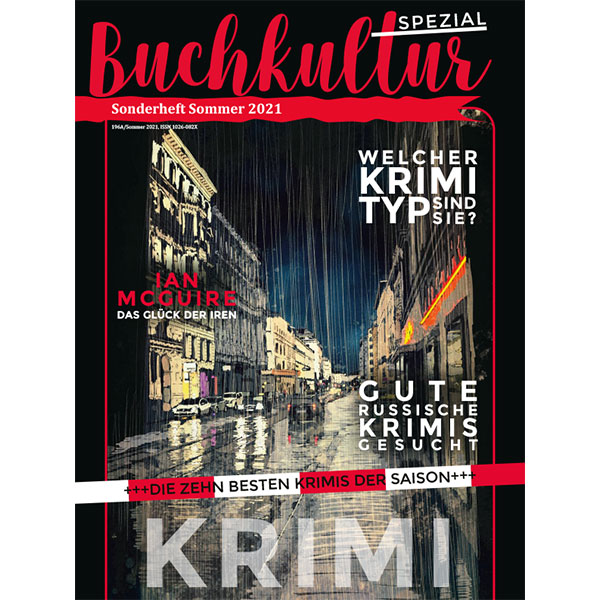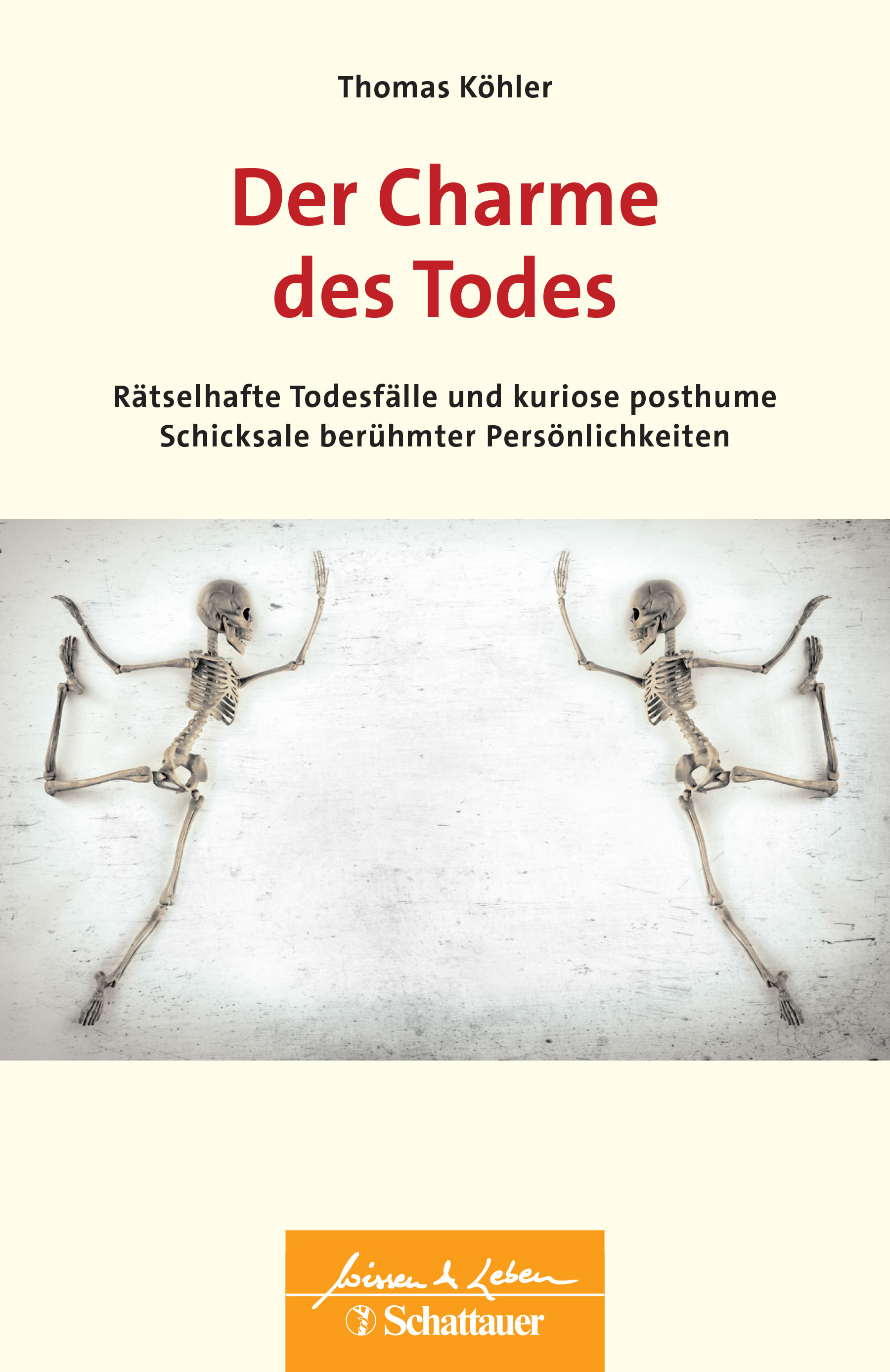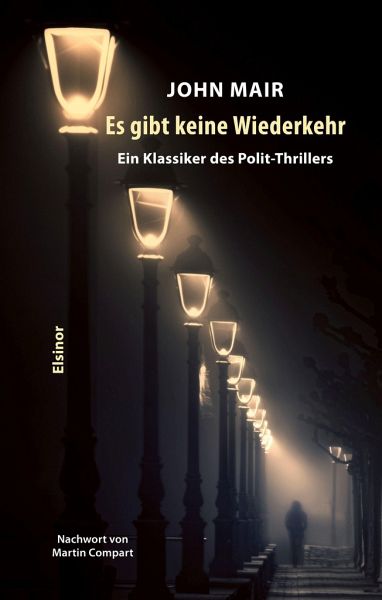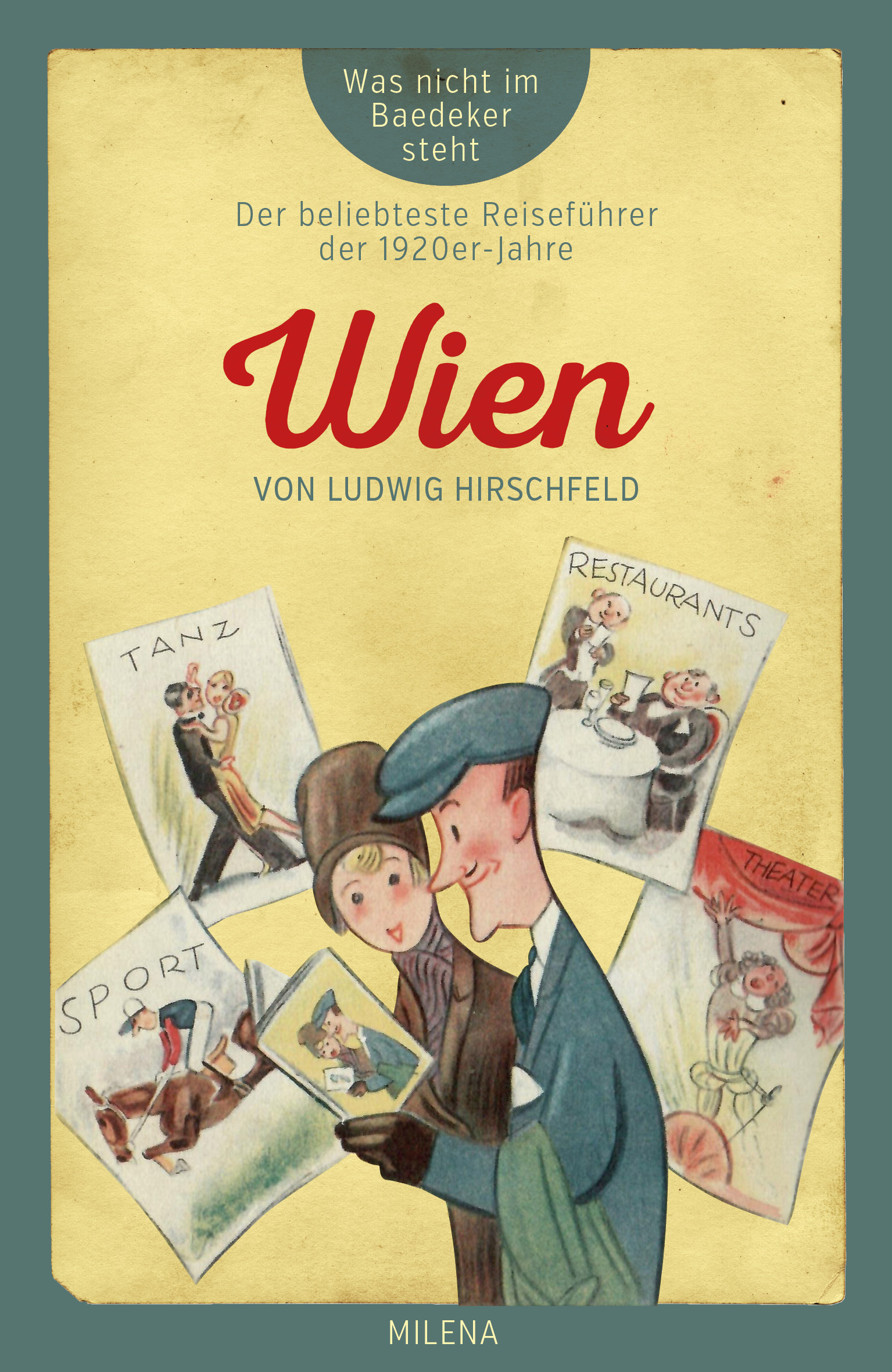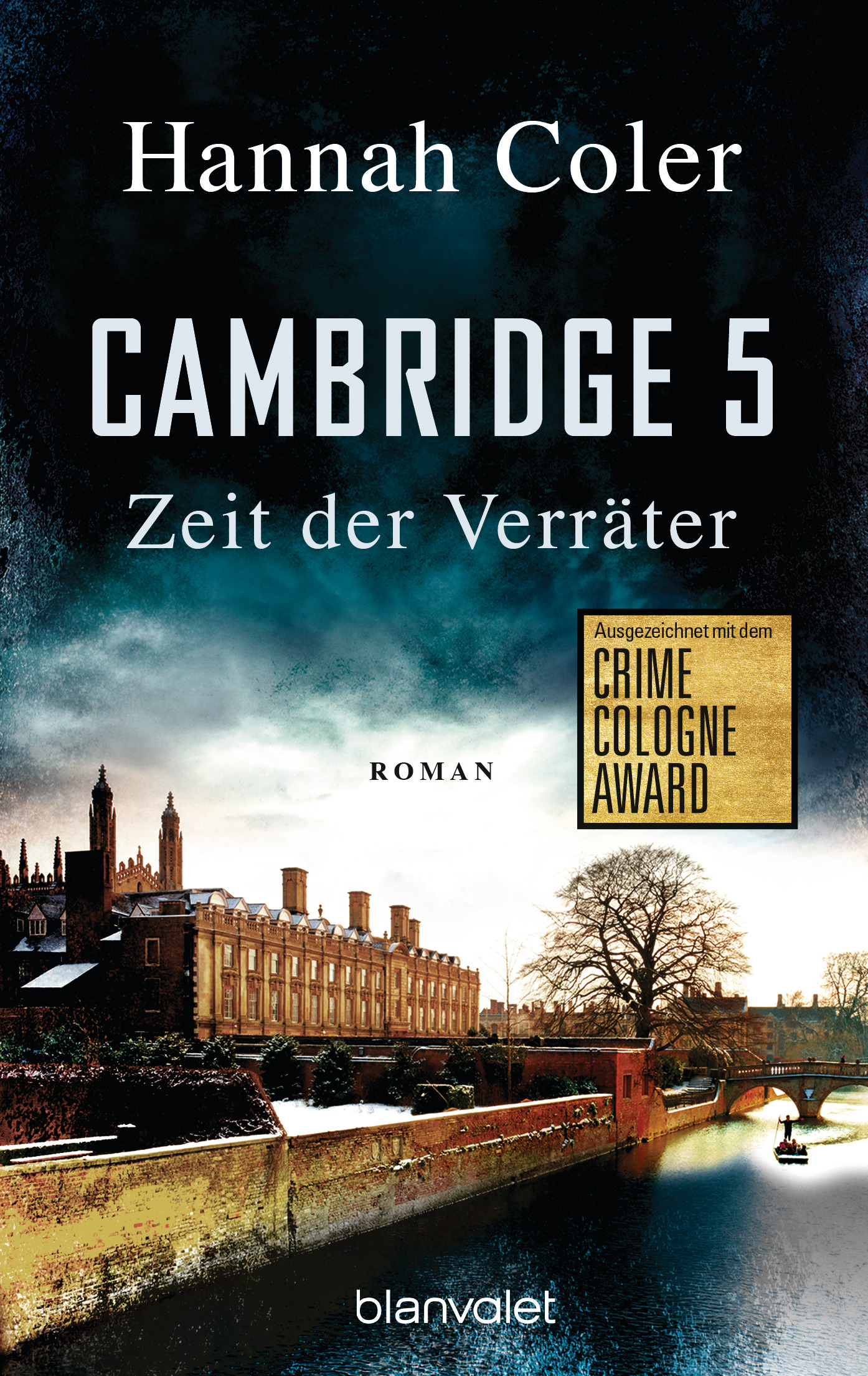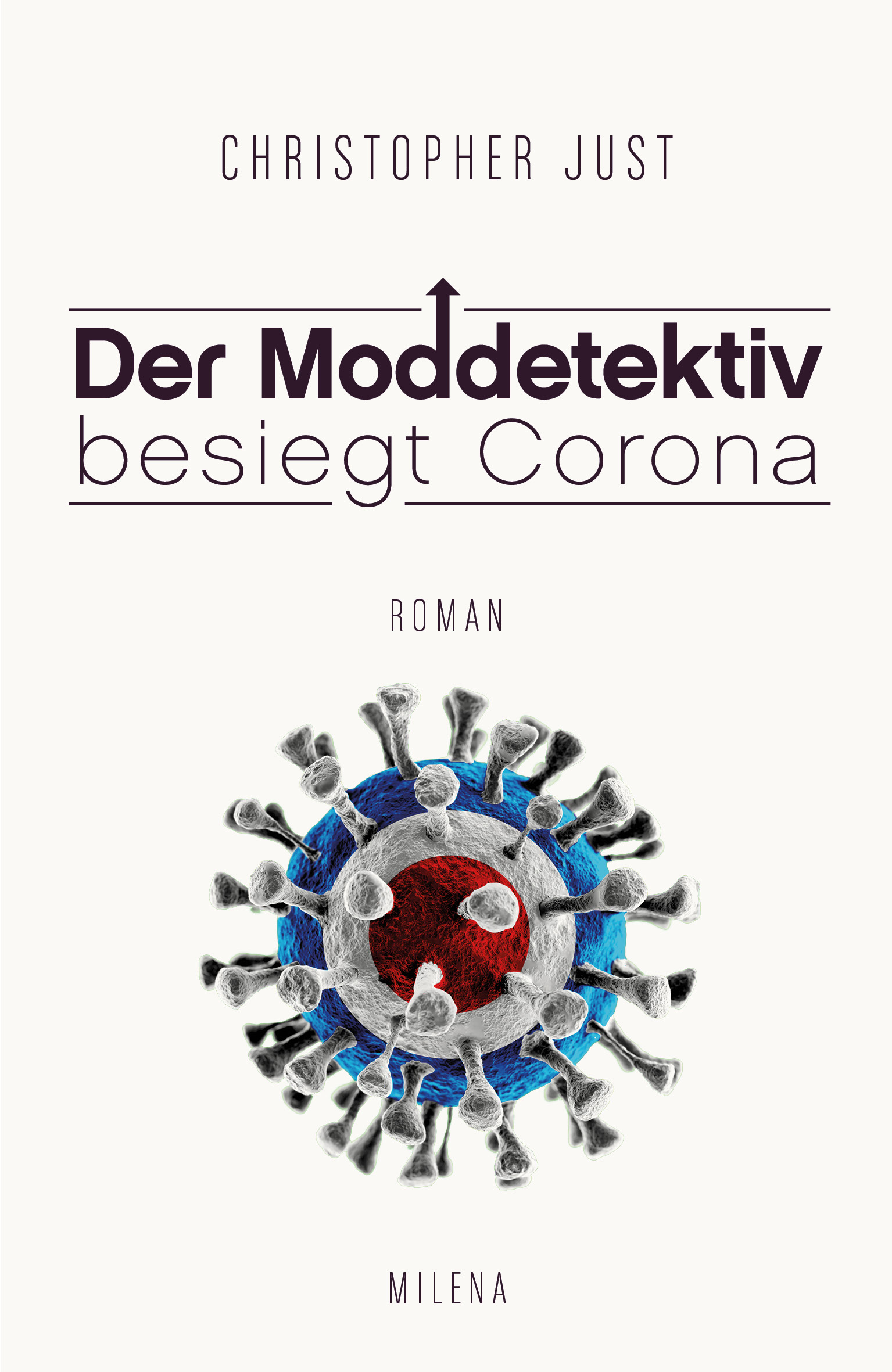Die Sekundärliteratur zum Krimi.
Willkommen bei Thomas Przybilka und BoKAS, dem Bonner Krimi Archiv (Sekundärliteratur).
Seit Jahren sammelt Thomas Przybilka Sekundärliteratur zum Krimi und informiert mit seinem Krimi-Tipp über Neuerscheinungen. Bisher erschienen (Stand Juli 2021) die folgenden Tipps. Das jeweils aktuelle Verzeichnis finden Sie auf der BoKAS-Startseite!
Krimi-Tipp 2021: 71
Krimi-Tipp 2020: 69, 70
Krimi-Tipp 2019: 68
Krimi-Tipp 2018: 67
Krimi-Tipp 2017: 65; 66;
Krimi-Tipp 2016: 63; 64
Krimi-Tipp 2015: 61; 62;
Krimi-Tipp 2014: 60;
Krimi-Tipp 2013: 59;
Krimi-Tipp 2012: 58; 57
Krimi-Tipp 2011: 55; 56;
Krimi-Tipp 2010: 54
Krimi-Tipp 2009: 52; 53
Krimi-Tipp 2008: 50; 51;
Krimi-Tipp 2007: 46; 47; 48; 49;
Krimi-Tipp 2006: 43; 44; 45;
Krimi-Tipp 2005: 38; 39; 40; 41, 42
Krimi-Tipp 2004: 33, 34, 35, 36, 36, 37
Krimi-Tipp 2003: 28, 29, 30, 31, 32
Krimi-Tipp 2002: 22, 23, 24, 25, 26 27
Krimi-Tipp 2001: 17,
18, 19,
20,
21.
Krimi-Tipp 2000: 11, 12, 13, 14, 15, 16
Krimi-Tipp 1999: 6, 7, 8, 9, 10
Krimi-Tipp 1998: 1, 2, 3, 4, 5
Hinweise oder Auszüge aus den Hinweisen, die mit dem Kürzel (tp) versehen sind, können für Werbezwecke zitiert werden - [bitte zitieren wie folgt: Thomas Przybilka, BoKAS - Bonner Krimi Archiv Sekundärliteratur].
Hinweis für die Verlage
To the Publishers
Hinweise oder Auszüge aus den Hinweisen, die mit dem Kürzel (tp) versehen sind, können für Werbezwecke zitiert werden - [bitte zitieren wie folgt: Thomas Przybilka, BoKAS - Bonner Krimi Archiv Sekundärliteratur].
Publishers may quote those parts of KTS, which are signed with (tp) - [please cite: Thomas Przybilka, BoKAS - Bonner Krimi Archiv Sekundärliteratur].
KRIMI-TIPP 71
Januar - Juli 2021
Ein Service des
BoKAS
mit Hinweisen und Rezensionen zu deutscher und internationaler Sekundärliteratur der Kriminalliteratur
www.krimilexikon.de/przybilk.htm
www.bokas.de
www.das-syndikat.com/autoren/autor/120-thomas-przybilka.html
https://www.youtube.com/watch?v=lE9RJQ7QXp4
Inhalt
Editorial
Hinweise
Schnellübersicht/Quick Search: Verlage/Publishers
„8 Fragen an ..“
Bibliographien / Nachschlagewerke / Referenzliteratur /
Aufsätze
Autorenporträts / Autobiographien / Biographien /
Werkschau
Film / TV / Hörspiel / Theater
Kriminalistik / True Crime / Spionage
Essen & Trinken / Schauplätze
Jahrbücher / Zeitschriften
Miscellanea
Investigations From „The Citadel – The Military College
of South Carolina“ – Dr. Katya Skow On Crime Fiction:
(Katya Skow, Charleston, SC / USA)
--- entfällt !!
Jim Madison Davis
(Jim Madison Davis, Palmyra, VA / USA)
1Expanding the World of the Private Eye: Walter Mosley
Becomes a Grand Master
Unter der Lupe
Martin Compart (Overath)
„Thriller“ & „Der Antiheld“
[Auszug aus dem Nachwort zu „John Mair: Es gibt keine
Wiederkehr. Ein Klassiker des Polit-Thrillers“]
Zu guter Letzt.
- „Bücherdiebe“
[Karina Urbach: Das Buch Alice. Wie die Nazis das
Kochbuch meiner Großmutter raubten]
- „Menschen Viren Widerlinge“
[Christopher Just: Der Moddetektiv besiegt Corona]
(Gitta List, Bonn)
Die Beiträger/innen
Bezugshinweis & Hinweis zum Datenschutz
Hinweis für die Verlage
To the Publishers
Hinweise oder Auszüge aus den Hinweisen, die mit dem Kürzel (tp) versehen sind, können für Werbezwecke zitiert werden - [bitte zitieren wie folgt: Thomas Przybilka, BoKAS - Bonner Krimi Archiv Sekundärliteratur].
Publishers may quote those parts of KTS, which are signed with (tp) - [please cite: Thomas Przybilka, BoKAS - Bonner Krimi Archiv Sekundärliteratur].
|
Editorial
Liebe Abonnenten des KTS,
es freut mich sehr, dass ich auch im aktuellen KTS wieder einmal auf einen Titel aus der Reihe „McFarland Companions to Mystery Fiction“, und zwar zu Ngaio Marsh, aufmerksam
machen kann. Für das Jahr 2021 ist der 11. Band dieser hervorragenden Serie geplant.
Zu einer kleinen Geschichtsstunde lädt –ky zusammen mit Rengha Rodewill ein: „-ky’s Berliner Jugend. Erinnerungen in Wort und Bild“. Und Herausgeber
Thomas W. Kniesche (Brown University) und seine MitarbeiterInnen des Kompendiums „Contemporary German Crime Fiction“ bringen anglophonen Krimilesern die deutsche Kriminalliteratur nahe. Sabine Binder (Universität
Zürich) analysiert in „Women and Crime in Post-Transitional South African Crime Fiction“ die Rolle der Frau als Opfer, Täterin und Ermittlerin in der Kriminalliteratur dieses Landes.
Zudem sind drei Bände aus der Reihe „Mîzân – Studien zur Literatur in der islamischen Welt“ (Harrassowitz Verlag) zu entdecken, die sich mit
der Kriminalliteratur des Nahen Osten (Bd. 23), des arabischen Sprachraums (Bd. 32) und der Türkei (Bd. 33) beschäftigen.
Ich hoffe, dass auch die Hinweise zu den vielen anderen Titeln dieses KTS auf Ihr Interesse stoßen.
Mit besten Grüssen
Thomas Przybilka
BoKAS
www.bokas.de
Hinweise
Alle bisher erschienenen Ausgabe des „Krimi-Tipp Sekundärliteratur“ sind unter www.bokas.de archiviert.
Die bisher erschienenen „Befragungen“ sind unter www.bokas.de/befragungindex.html archiviert.
Der „Krimi-Tipp Sekundärliteratur“ wird seit vielen Ausgaben von Prof. Norbert Spehner (Quebec/Kanada) für sein französischsprachigen Newsletter „Marginalia – Bulletin bibliographique des études internationales sur les littératures populaires“ übernommen. Im Netz nachzulesen unter http://marginalia-bulletin.blogspot.de/ oder www.scribd.com/marginalia. Wer den Newsletter abonnieren möchte, wende sich an nspehner@sympatico.ca.
Den Newsletter der Krimibestenliste hat Tobias Gohlis Ende 2020 eingestellt. Wer alle neuen Beiträge auf der Homepage von Tobias Gohlis unter https://recoil.togohlis.de/ abonniert, wird auch weiter regelmäßig Texte zu Krimis der Bestenliste und die monatliche Krimibestenliste
erhalten.
Auszüge aus dem „Krimi-Tipp Sekundärliteratur“ werden von „culturmag“ übernommen und erscheinen dort als „Pick of the Week“ im Bereich „crimemag“: http://culturmag.de
Empfehlenswert ist ein Abonnement des „KrimiDetektor – Die internationale Presseschau für Kriminalliteratur“: www.krimidetektor.de.
Schnellübersicht / Quick Search
Verlage / Publishers
ars vivendi
Blanvalet
Books on Demand
Brill / Rodopi
Buchkultur
CADS
Cambridge Scholars
Centre Dürrenmatt Neuchâtel CDN
de Gruyter
DVA
Ed. L’Harmattan
Elsinor
S. Fischer
Gmeiner
Goldmann
Harrassowitz
|
Haymon
ibidem
iz3w
JGG
Limes
CH. Links
McFarland
Metzler
Milena
Propyläen
Psychosozial
Reclam
Schattauer / Klett-Cotta
Vergangenheits Verlag
Wildside Press
WVT – Wissenschaftlicher Verlag Trier
|
|
8 Fragen an
Martin COMPART
Tessa KORBER
Elmar TANNERT
Eine Aufstellung aller bisherigen Kurzinterviews
„8 Fragen an … / 8 Questions to …“
jeweils am Schluß des aktuellen „Krimi-Tipp Primärliteratur“ (KTP)
|
|
Bibliographien
Nachschlagewerke /
Referenzliteratur /
Aufsätze
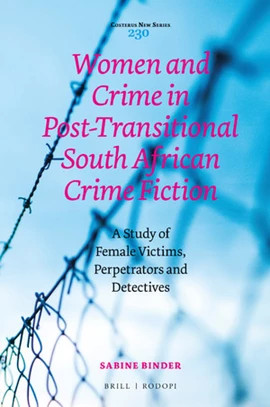
Binder, Sabine:
Women and Crime in Post-Transitional South African Crime Fiction. A Study of Female Victims, Perpetrators and Detectives.
2020,
VIII/244 S., Brill (Costerus New Series, Bd. 230), 90-04-43743-6 / 978-90-04-43743-2, EURO 99,00
Die Schweizer Sabine Binder, Dozentin an der Universität Zürich, war vor einigen Jahren Gast an der Universität Stellenbosch, um zur südafrikanischen Kriminalliteratur
zu forschen. Das Ergebnis ihres Forschungsaufenthalts liegt jetzt als Analyse über weibliche Opfer, Detektive und Täter im südafrikanischen Krimi nach Beendigung der Apartheid vor. Sabine Binder hat dafür
zahlreiche südafrikanische Kriminalromane, auch im Hinblick auf deren feministisches Potential begutachtet. Die vorliegende Analyse zeigt auf, dass der südafrikanische Kriminalroman sich als Plattform für eine
soziale, kulturelle und ethische Debatte versteht. Im Fokus dieser Kriminalliteratur stehen oftmals Themen wie Gerechtigkeit für weibliche Opfer, Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Für diese Arbeit hat Sabine Binder
die Kriminalromane von Penny Lorimer, Malla Nunn, Margie Orford, Mike Nikol, Jassy Mackenzie, Angela Markholwa, Michéle Rowe, Hawa Jande Golakai und Charlotte Otter und deren ProtagonistInnen ausführlich analysiert.
Inhalt:
--- Introduction: Choice of Texts and Approach / Post-Transitional Literature / Post-Transitional Crime Fiction and Crime Discourse / Post-Transitional Gender Conflicts / Preview
of Chapters.
--- 1. The Female Victim: Whose Story is Written on Her Dead Body? Exploring the Gender Politics of Writing Female Victims and Their Traumas:
The Female Victiom. Introduction / Boniswa Sekeyi and Lulu. Witnesses of Systematic and Sexual Violence in Penny Lorimer’s „Finders Weepers“ / Resisting Arrest.
Amahle Matebula, Female Victim in Malla Nunn’s „Blessed Are the Dead“ / Serial Female Victimhood. Margie Orford’s Clare Hart Series / The Female Victim. Conclusion.
--- 2. The Female Perpetrator: Doing and Undoing Masculinity Through Crime – Exploring the Meanings and Politics of Female Counter-Violence:
The Female Perpetrator. Introduction / Mike Nicol’s Femme Fatale Sheemina February. Empowered Female Agent of Symptom of Male Fears? / Jassy Mackenzie’s Renegade Detective
Jade de Jong. Exploring Femininity and Justice / Angela Makholwa’s Black Widow Society. Collective Female Terror against Gender Norms / The Female Perpetrator. Conclusion.
--- 3. The Female Detective: Agent of (Gender) Justice? Exploring Female Detective Agency and Investigation:
The Female Detective. Introduction / Not That Kind of Cop. Michéle Roew’s Detective Constable Persy Jonas / Not What South Africans Expect. Hawa Jande Golakai’s
Investigator Vee Johnson / Renegade Contained. Charlotte Otter’s Investigative Journalist Maggie Cloete / The Female Detectiv. Conclusion.
--- Conclusion / Works Cited / Index.
Sabine Binder ist Dozentin an der Zürcher Universität für Lehrerbildung. Sie hat über südafrikanische Krimis, Gender
und Lehrmethoden publiziert.
www.phzh.ch/personen/sabine.binder
(tp) KTS 71
|
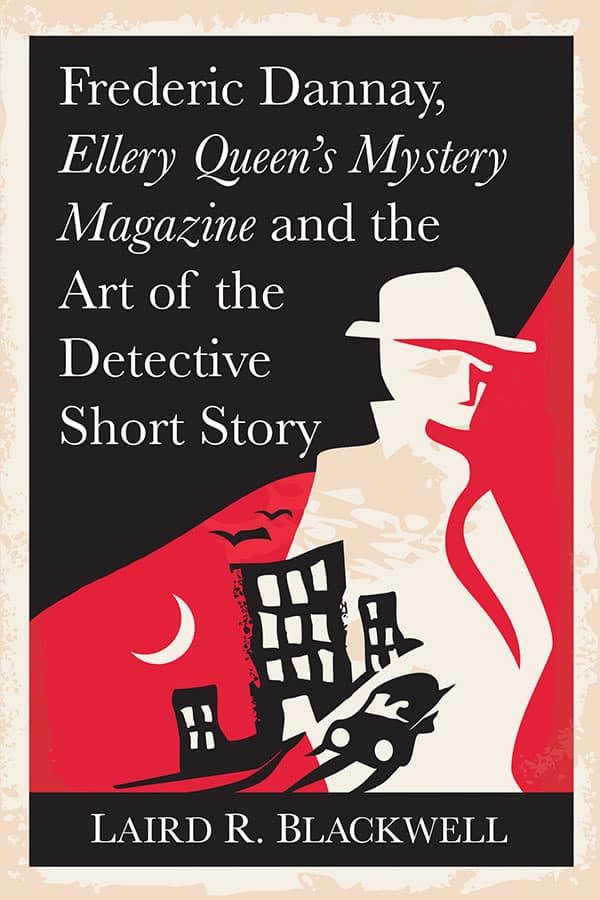
Blackwell, Laird R.: Frederic Dannay, Ellery Queen’s Mystery Magazine and the Art of the Detective Short Story.
2019, 218 S., McFarland & Company, 1-4766-7652-6 / 978-1-4766-7652-4, US $ 49,95
Hinter dem pen-name Ellery Queen verbargen sich die Cousins Frederick Dannay (20.10.1905-3.9.1982) und Manfred B(ennington) Lee (11.1.1905-3.4.1972), die zusammen Kriminalromane
schrieben deren Protagonist ebenfalls Ellery Queen hieß! Im Herbst 1941 brachte Mercury Press erstmals das „Ellery Queen‘s Mystery Magazine“ auf den Markt. Die monatliche Publikation war Nachfolgemagazin
von „Mystery League“. Frederic Dannay fungierte von 1941 bis 1982 als Herausgeber, gefolgt von Eleanor Sullivan (1982-1991), seit 1991 liegt die Herausgeberschaft in den Händen von Janet Hutchings. Das vorliegende
Werk von Laird R. Blackwell wirft einen Blick auf die Kurzkrimis der EQMM-Autoren und Autorinnen aus dem Zeitraum von 1929 bis 1980. Die themenbezogenen Kapitel verzeichnen kurze Inhaltsangaben der Kriminalerzählungen,
analysieren den Stil dieser Kurzkrimis, berichten über die Protagonisten und geben Auskunft über Nominierungen und verliehene Preise. „Frederic Dannay, Ellery Queen’s Mystery Magazin and the Art of the Detective Short Story“ kann sowohl als informatives Nachschlagewerk wie auch als Auswahlbibliographie genutzt
werden. Die autorenalphabetisch gelisteten Titel der Kurzkrimis im Anhang verzeichnen sowohl die (Autoren-)Originaltitel wie auch die entsprechenden Titelfindungen des Magazins.
Inhalt:
Acknowledgments / Preface / Introduction: Queen as Champion of the Past and Patron of the Future / From Thinking Machine to Human Being – From Ellery I to Ellery II / A Quorum
of Queens, the Old Masters and the New Masters / A Never-Ending Stream of Manuscripts / The Old Masters Resusitated / The New Masters Celebrated / The Acclaimed and the Awarded / „Tec Tyros“ as Masters of the Future
/ Other Significant Debuts / The Fine Arts of Parody, Pastiche and Spoof / Queen as Champion, Cheerleader, Critic and Patron / Appendix: Story Titles / Works Cited / Index.
Laird R. Blackwell ist Prof. em. des Sierra Nevada College, zur Zeit lehrt er an der Tahoe Expedition Academy. Er lebt in Washoe Valley, Nevada.
(tp) KTS 71
|
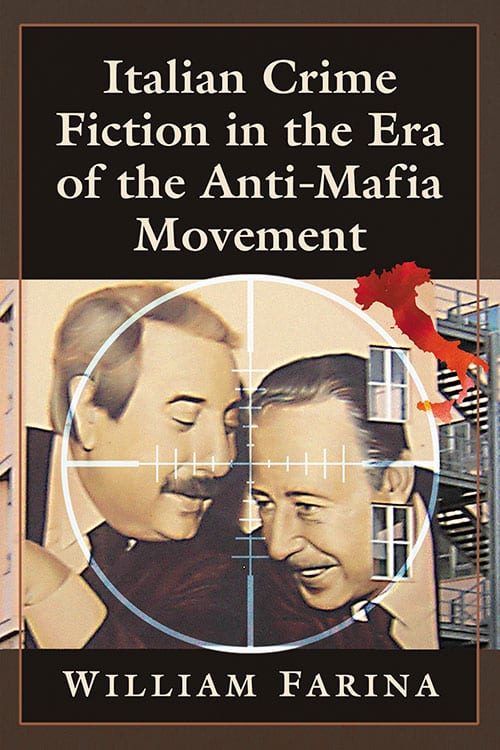
Farina, William:
Italian Crime Fiction in the Era of the Anti-Mafia Movement.
2020, 226 S., McFarland & Company, 1-4766-7735-2 / 978-1-4766-7735-4,
US $ 65,00
Am 23. Mai 1992 wurde Italiens führender Anti-Mafia Richter Giovanni Falcone zusammen mit Bodyguards und seiner Ehefrau in der Nähe von Palermo ermordet. Wenig später,
am 19. Juli 1992, fiel auch Paolo Borsellino, ebenfalls Anti-Mafia Richter und Freund Falcones, einem Attentat zum Opfer. Auftraggeber und Hintermänner dieser beiden tötlichen Attentate war die sizilianische Mafia,
bekannt unter dem Namen „Cosa Nostra“. Für die italienische Kriminalliteratur waren diese beiden Attentate ausschlaggebend und wegweisend für eine intensive fiktionale Beschäftigung mit dieser italienischen
Terrororganisation. William Farina bezeichnet diese neuen Krimi-Richtung als „New Italian Epic“. Farina analysiert in seinem Werk die Geschichte der Mafia und der mafiösen Strukturen, um sich dann mit den
Arbeiten einiger italienischer Autoren und einen englischsprachigen Autoren zu beschäftigen. Wer Interesse an den Krimis dieser Autoren und der Entwicklung der jüngsten italienischen Geschichte hat, findet in „Italian
Crime Fiction in the Era of the Anti-Mafia Movement“ ausführliche Informationen. Eine Readinglist englischsprachiger Bücher der im Inhalt aufgeführten Autoren ergänzt Farinas Untersuchung.
Inhalt:
Acknowledgments / Introduction / Ancient Origins / Roberto Savioano / Norman-Arab Feudal Code / Wu Ming / Spanish Black Legend / Gianrico Carofiglio / Risorgimento Roots / Maurizio
de Giovanni / Little Hell / Massimo Carlotto / Saint Valentine’s Day Massacre / Giancarlo de Cataldo / Unlikely Allies / Elena Ferrante / Cosa Nostra Resurgence / Michele Giuttari / Falcone and Borsellino / Michael Dibdin
/ Sicilian Backlash / Andrea Camilleri / Summery / Chapter Notes / Selected Reading (English Language) / Index.
William Farina hat zahlreiche Veröffentlichungen (wie zur Artuslegende, frühem Christentum, amerikanischen Bürgerkrieg, Shakespeare
und Baseball) vorgelegt. William Farina lebt in Chicago.
www.williamfarina.com
(tp) KTS 71
|
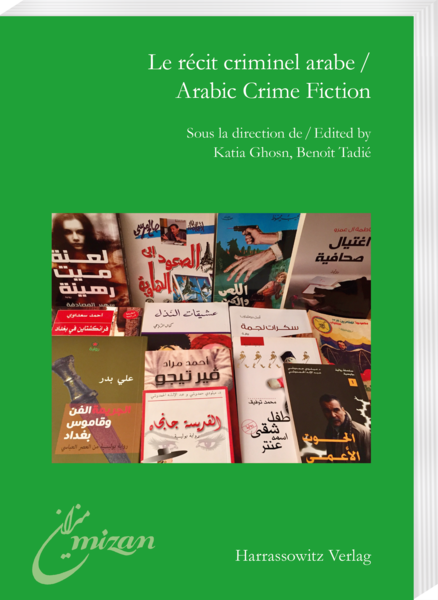
Ghosn, Katia / Tadié, Benoît (Hg):
Le récit criminel arabe / Arabic Crime Fiction.
2021, VI/268 S., 3 Abbildungen, Harrassowitz
Verlag (Mîzân – Studien zur Literatur in der islamischen Welt, Bd. 32), 3-447-11576-9 / 978-3-447-11576-6, EURO 58,00
Arabic fiction has thematized crime ever since the classical period. However, the existence of detective stories or, more generally, of crime fiction as a genre within Arabic culture
has yet to be fully acknowledged. This book therefore offers both a theoretical reflection on this genre in its context and a set of studies on instance of crime fiction in the Arab world. Covering a vast historical and geographical
range, it tackles famous writers as well as authors of young adult fiction, deals with the current practitioners of noir as well as with classical detective stories, as also focuses on the adjacent fields of film and television
production. „Arabic Crime Fiction / Le récit criminel arabe“ thus fills a theoretical and historical gap in current scholarship. Bringing together specialists of Arab literature and cinema and/or crime fiction,
it provides an overview of a rich and varied genre, at the crossroads between the narrative, philosophical, and legal traditions of the Arab world, the realities of contemporary society, and the international forms of crime
fiction. It thus demonstrates that Arabic crime fiction does, indeed, exist, even though it is not yet fully recognized by the publishing market and academic institutions.
Inhalt:
Katia Ghosn / Benoît Tadié: Introduction. Le récit criminel arabe existe-t-il? / Mathieu Tillier: Judicial Investigations in Classical Islam / Benoît
Tadié: „Man qatala Laylā al-Hāyik?“ de Gassān Kanafānī, ou le roman policier impossible / Katia Ghosn: Mahfūz lecteur de Kanafānī? L’Invisible dans „Tahqiq“
et „al-Say’al ahar: Man qatala Laylā al-Hāyik?“ / Heidi Toelle: „Turab al-mās“ d’Ahmad Murād. Quand chacun se transforme en juge et bourreau / Hartmund Fähndrich:
Crimes in Mecca. Is Ragā‘ Alim’s „Tawq al-hamam“ a Detective Story? / Najeb Jegham: L’envers du monde ou la décomposition à l’œuvre. Une lecture d‘„al-Misrat“
de Kamāl al-Riyāhi / Jolanda Guardi: Le roman policier algérien en langue arabe- „Nahadat ahir al-layl“ de Nasima Būlūfa / Alessandro Buontempo: Scanning Violence Untold. The Detective’s
Voice in Arabic Crime Fiction / Xavier Luffin: The Peregrinations of a Sudanese Detective in Cairo. A Focus on Parker Bilal’s „Dogstar Rising“ / Rima Samman: „Le Caire confidentiel“ Un film qui
déconstruit le système de corruption politique de Hosni Moubarak / Gianluca Parolin: Enquêteurs (non) familiers. Qui mène les enquêtes dans les séries télévisées
égyptiennes? / Emily Drumsta: Interview with ‘Abdul’ilāh Hamdūsi / Aram A. Shahin: The Life and Work of Mahmud Sālim. A Pioneer of the Arabic Detective Novel / Bibliographie / Les auteurs.
(vt) KTS 71
|
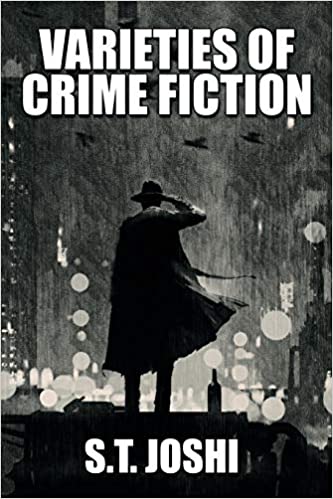
Joshi, Sunand T.:
Varieties of Crime Fiction.
2019, 212 S., Wildside Press, 1-4794-4546-0 / 978-1-4794-4546-2, US $ 15,99
Eine Zusammenstellung von insgesamt 13 Analysen und Werkübersichten, ergänzt und begleitet von Rezensionen und Kritiken des Krimikritikers Sunand T. Joshi zu Kriminalromanen
und deren Autorinnen und Autoren aus den USA und Großbritannien, welche die Krimiszene maßgeblich geprägt haben. Das vorliegende Werk „The Varieties of Crime Fiction“ ist eine Zusammenstellung
von Artikeln der letzten Jahre aus seinem blog.
Inhalt:
Introduction.
I. The Golden Age (Dorothy L. Sayers: Lords and Servants / John Dickson Carr: Puzzlemeister / Margery Allingham: Murder, Gangs, and Spies / Philip MacDonald: Expanding the „Cosy“
Mystery).
II. The Hard-Boiled School (Dashiell Hammett: Sam Spade and Others / Raymond Chandler: Mean Streets / Ross Macdonald: Family Affairs).
III. The Psychological Mystery (Margaret Millar: Scars and the Psyche / Patricia Highsmith: Guilt and Innocence / P.P. Davies: The Workings of the Mind).
IV: Some Contemporaries (P.D. James: The Empress’s New Clothes / Ruth Rendell: The Psychology of Murder / Sue Grafton: Hard-Boiled Female).
Bibliography.
S(unand) J. Joshi ist freier Autor und Herausgeber von „The Collected Fables of Ambrose Bierce“ sowie Autor von „H.P. Lovecraft. A Life“.
(tp) KTS 71
|
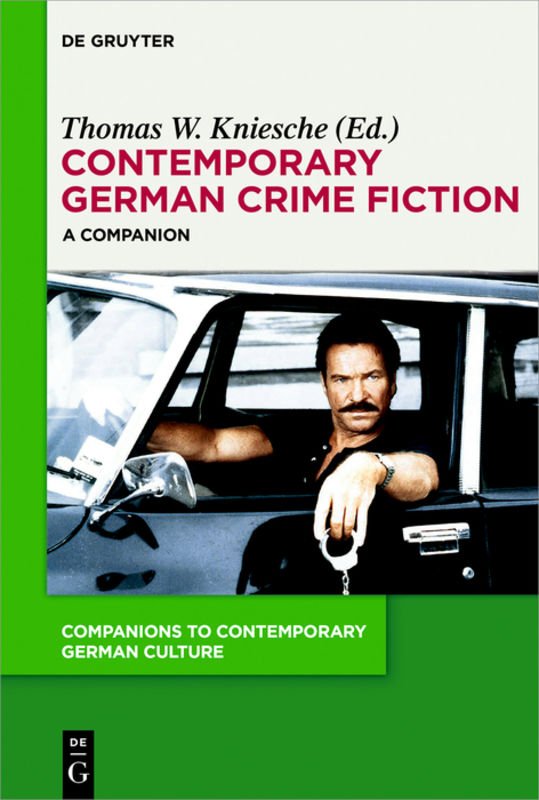
Kniesche, Thomas W. (Hg):
Contemporary German Crime Fiction. A Companion.
2019, 336 S., Walter de Gruyter (Companions to Contemporary German Culture,
Bd. 7), 3-11-042655-2 / 978-3-11-042655-7, EURO 24,95
Herausgeber Thomas W. Kniesche dürfte den Abonnenten des KTS als Autor von Referenzwerken zur Kriminalliteratur ein Begriff sein. Sein hier vorgestelles Werk vermittelt Lesern
in der anglophonen Welt ein umfassendes Bild und pointierten Blick auf die deutschsprachige Kriminalliteratur. Hierfür konnte Thomas W. Kniesche ausgewiesene Experten auf dem Gebiet des deutschsprachigen Krimis zur Mitarbeit
gewinnen. Neben einem kurzen Überblick zur deutschen wie internationalen Kriminalliteratur werden einzelne Subgenres (Soziokrimi, NDK, Frauenkrimi etc) analysiert, sowie eine überschaubare Auswahl von wichtigen und
richtungsweisenden Kriminalschriftstellerinnen und –schriftstellern im Porträt vorgestellt und ausführlich auf ihr Werk eingegangen. Der Anhang verweist in einer Bibliographie der Primärliteratur auf jene
AutorInnen, die in den Augen des Herausgebers wie auch der Beiträger wichtig sind, um den englischsprachigen Lesern mit deutschen Sprachkenntnissen die deutschsprachige Kriminalliteratur in ihren verschiedenen Facetten
zu vermitteln. Eine (erfreulich) ausführliche Aufstellung weiterführender (internationaler) Literatur ergänzt und ein Index erschließt das Werk.
Inhalt:
Vorwort / Thomas W. Kniesche: Introduction. German and International Crime Fiction / Gonçalo Vilas-Boas: The Beginnings of Swiss Detective Literature. Glauser and Dürrenmatt
/ Thomas W. Kniesche: Modernity and Melancholia. Austrian Crime Fiction / Thomas W. Kniesche: The Soziokrimi or Neuer Deutscher Kriminalroman / Jochen Vogt: Regionalism and Modernism in Recent German Crime Fiction (1990-2015) / Gaby Pailer:
Female Empowerment. Women’s Crime Fiction in German / Thomas W. Kniesche: Crime Fiction as Memory Discourse. Historical Crime Fiction from Germany / Sandra Beck: The Legacy of the „Third Reich“. Reworking
the Nazi Past in Contemporary German Crime Fiction / Sandra Beck: Blood, Sweat and Fears. Investigating the Other in Contemporary German Crime Fiction / Thomas Wörtche: Crime Fiction and the Literary Field in Germany.
An Overview / William Collins Donahue & Jochen Vogt: Portal to the Humanities. Teaching German Crime Fiction in the American Academy / Thomas W. Kniesche: Friedrich Ani / Thomas Wörtche: Zoë Beck / Jochen Vogt:
Oliver Bottini / Kirsten Reimers: Simone Buchholz / Sandro M. Moraldo: Jörg Fauser / Kirsten Reimers: Monika Geier / Thomas W. Kniesche: Gisbert Haefs / Jochen Vogt: Uta-Maria Heim / Steffen Richter: Veit Heinichen /
Andreas Erb: Bernhard Jaumann / Kirsten Reimers: Merle Kröger / Kirsten Reimers: Christine Lehmann / Hugh Ridley: Ulrich Ritzel / Joachim Feldmann: Bernhard Schlink / Contemporary German Crime Fiction. A Bibliographie
/ Contributors / Index.
Thomas W. Kniesche ist Associate Professor für Deutsch an der Brown University. Veröffentlichungen über Günter Grass, deutsch-jüdische
Literatur, Kriminalliteratur und deutsche SiFi-Literatur. Letzte Veröffentlichungen: „Einführung in den Kriminalroman“ (2015) und „Büchermorde – Mordsbücher“ (2016).
www.vivo.brown.edu/display/tkniesche#
(tp) KTS 71
|
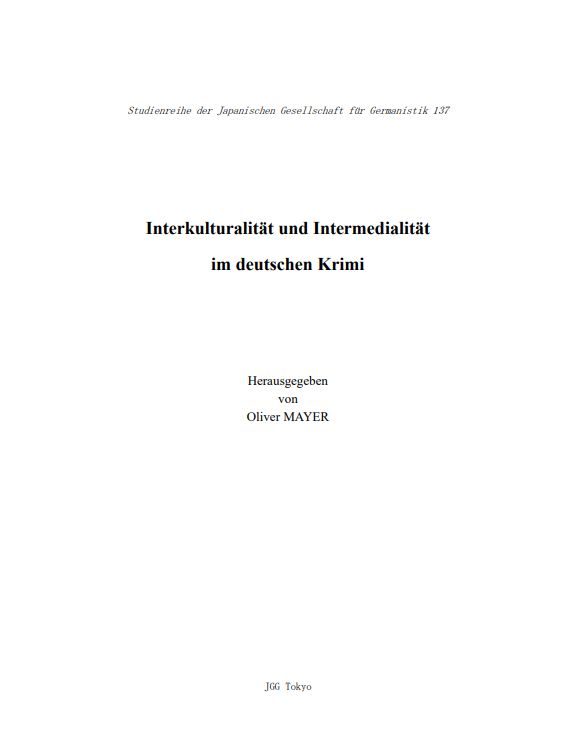
Mayer, Oliver (Hg):
Interkulturalität und Intermedialität im deutschen Krimi.
2019, 81 S., JGG – Japanische Gesellschaft für
Germanistik e.V. Tokyo (Studienreihe der Japanischen Gesellschaft für Germanistik, Nr. 137), 978-4-908452-27-7, [Preis nicht mitgeteilt]
Im Sommer 2010 wurde dem BoKAS freundlicherweise von Associate Professor Oliver Mayer und Professor Dr. Robert F. Wittkamp ein schmales JGG-Bändchen mit dem Titel „Mord
auf Deutsch“ zugeschickt [siehe KTS 55, Juli-Dezember 2010]. Vor wenigen Tagen erreichte das Archiv über Prof. Oliver Mayer eine weitere Publikation der Japanischen Gesellschaft für Germanistik – JGG.
In „Interkulturalität und Intermedialität im deutschen Krimi“ sind vier Vorträge versammelt, die während der Herbsttagung am 29. September 2018 an der Universität Nagoya gehalten wurden.
Es ist die inzwischen dritte Tagung in Japan, die Aufschluss über die Forschung der japanischen Germanistik zur deutschen Kriminalliteratur und zum deutschen TV-Krimi gibt. Die beiden ersten hier publizierten Vorträge
beschäftigen sich mit den Kayankaya-Krimis von Jakob Arjouni und den Inspektor Takeda-Krimis von Henrik Siebold sowie einem Krimi von Carsten Germis, die beiden letzten Vorträge widmen sich den Fernsehkrimis unter
anderem aus der „Tatort“-Reihe, die 2016 und 2017 ausgestrahlt wurden. Die Beiträge dieses Bändchens sind in japanischer und in deutscher Sprache. Interessierte können diese Publikation als kostenlose
PDF-Version herunterladen: http://www.jgg.jp/pdf/updata/SrJGG137neu.pdf.pdf
Inhalt:
Oliver Mayer: Vorwort [deutsch] / Takao Nagasawa: Wiederholtes Vergraben. Zu Jakob Arjounis „Kayankaya-Romanen“ [japanisch] / Oliver Mayer: Ermittlungen im Ausland
– Inspektor Takeda in Hamburg und Kommissar Ahlweg in Tokyo [deutsch] / Stefan Buchenberger: Intertextuelle Spurensuche im Tatort. Zwei Münchner Folgen zwischen Japan, Hollywood und einem realen Mordfall [deutsch]
/ Kaori Yokoyama: Fernsehadaptionen deutschsprachiger Kriminalromane. Eine Analyse am Beispiel von vier ausgewählten Fernsehkrimis [japanisch] / Diskussion [deutsch].
Oliver Mayer, geb. 1968 in Essen. Japanologie-Studium in Bochum, anschliessend Assistent am Geographischen Institut der Ruhr-Universität Bochum. Seit 2001 an der Pädagogischen
Hochschule Aichi in Japan tätig, dort seit 2017 als Professor am Department of Educational Administration and Governance. Forschungen u.a. zu Deutsch als Fremdsprache und zur Kriminalliteratur. Veröffentlichungen
u.a. „Yakuza, Kampfsport und roher Fisch. Japan im deutschen Kriminalroman“ (2005) und „Die Japan-Krimis der Yuka-Sato-Reihe von Andreas Neuenkirchen“ (2020).
www.olivermayer.de/
(tp) KTS 71
|
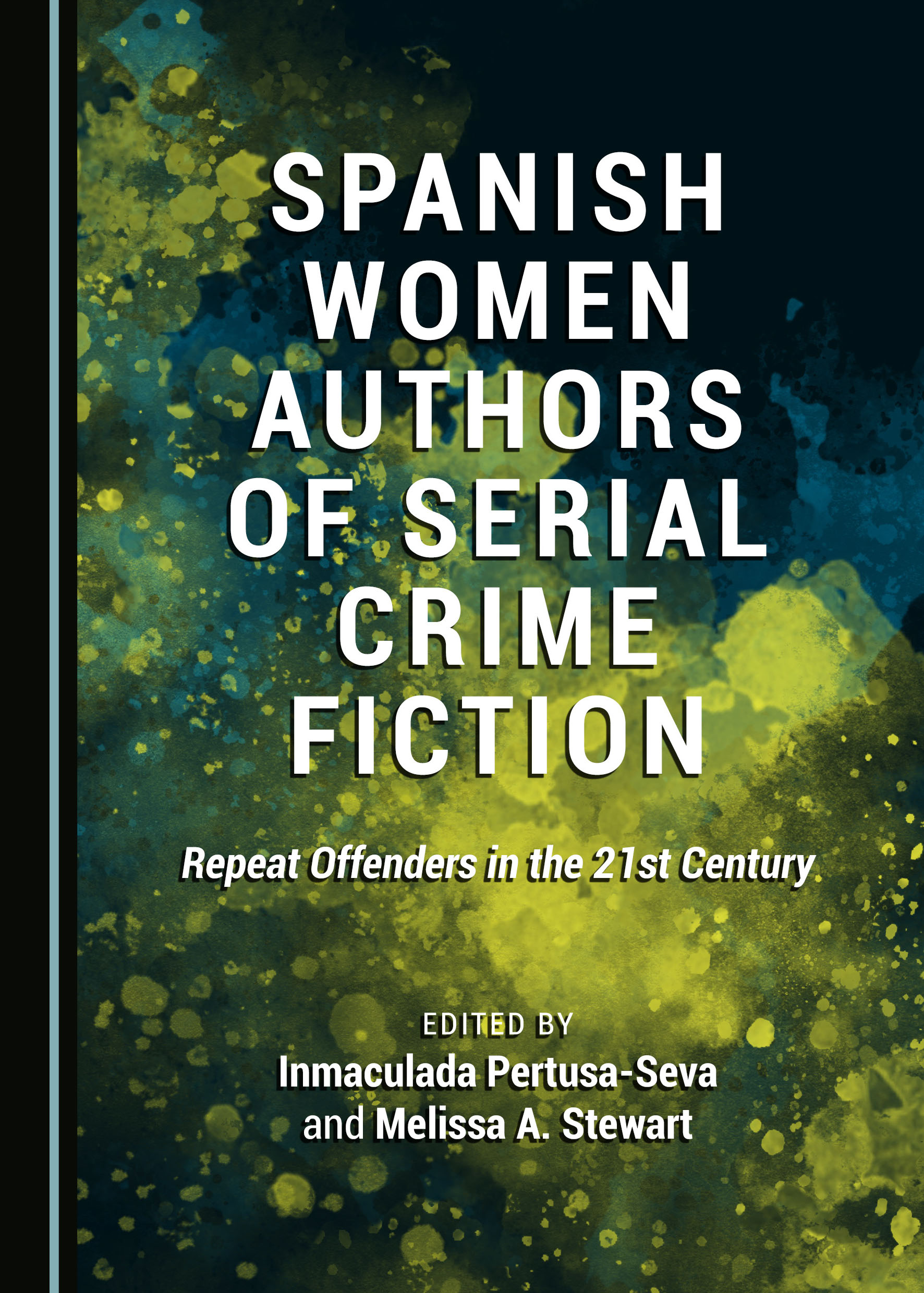
Pertusa-Seva, Immaculada / Stewart, Melissa A. (ed):
Spanish Women Authors of Serial Crime Fiction. Repeat Offenders in the 21st Century.
2020,
XXX / 254 S., Cambridge Scholars, 1-5275-4894-5 / 978-1-5275-4894-7, £ 61,99
Die Autorinnen und Autoren dieser Essay-Sammlung analysieren aktuelle spanische Detektiv- und Kriminalroman-Serien, die den Schwerpunkt auf Ermittlerinnen legen. Sie blicken auf
die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Zustände des heutigen Spaniens und verbinden diese mit den Themen Geographie (rural wie urban), Globalisierung, Umwelt, Technologie und – natürlich – Genderdiskurs.
Inhalt:
--- Introduction: In the Mind of a Serial Writer.
Pertusa-Seva, Immaculada: Exploring the Expansion of Criminal Series by Spanish Women Authors. / Stewart, Melissa A.: The Critics‘ Turn. „Forensic“ Analysis of
Literary Crime Series.
--- Prologue:
McKerney, Kathleen: A Reluctant Pioneer. Maria-Antònia Oliver.
--- Section I: Cybercrime, Cyborgs, and the Role of Technology.
Drumright, Kelly J.: The „Not-So-Lonely Spider“. Conciousness-Raising and (Cyber)Activist Ethics in Antonia Huertas’s Networked Crime Fiction. / Thompson-Casado,
Kathleen: The Evolution of Death in the Bruna Husky Novels.
--- Section II: Crime Fiction Moves into Alternative Spaces and Settings.
Stewart, Melissa A.: Recent Trends in the Nove.la Negra by Female Catalan Authors. / Paris-Huesa, Eva: De la urbe mitica a la periferia história. La búsqueda de nuevos espacios e identidades globales en al serie literaria de Susana Martín
Gijón. / Molinaro, Nina: Serial Tensions and Dolores Redondo’s Baztán Trilogy.
--- Section III: The State of Gender Politics, New Readings and Sexuality and Connections with Contemporary Reality in Spain and Beyond.
Losada Soler, Elena: Berna González Harbour. La serie de la comisaria María Ruiz. / Godsland, Shelley: Gendered Fragility in Graziella Moreno’s Judge Sofia
Valle Novels. / Tobin Stanley, Maureen: Gastronomical and Gynocentri Spanish Noir in the 21st Century. Cuisine, Patriarchy and Ageusia in „El Chef ha muerto“ and „Matar al padre“ by Yanet Acosta. / Arambaru, Diana: Reading From The Lesbian Detective Body.
Queering Pleasure and Pain in Clara Asunción García’s Cate Maynes Novels. / Oxford, Jeffery: Will the Real Lola MacHor Please Rise?
--- Section IV: Hybridization.
Oropesa, Salvador: The Cozy Mystery in the María Oruña Series. / Serra, Fátima: Vitoria, la ciudad blanca. Subversive Noir in the Fiction of Eva G. Sánez de Urturi. / Vosburg, Nancy: Murder in Minorca. Hybridization in the Rebeca Dorado Crime Series.
Immaculada Pertusa-Seva ist Professorin für Spanisch an der Western Kentucky University. Ihr Veröffentlichungen beschäftigen sich mit zeitgenössischen spanischen Autorinnen.
www.wku.edu/modernlanguages/staff/inma-pertusa
Melissa A. Stewart ist Professorin für Spanisch an der Western Kentucky University. Zahlreiche Veröffentlichungen
zu katalanischen SchriftstellerInnen und zur spanischen Kriminalliteratur.
www.wku.edu/modernlanguages/staff/melissa-stewart
(tp) KTS 71
|
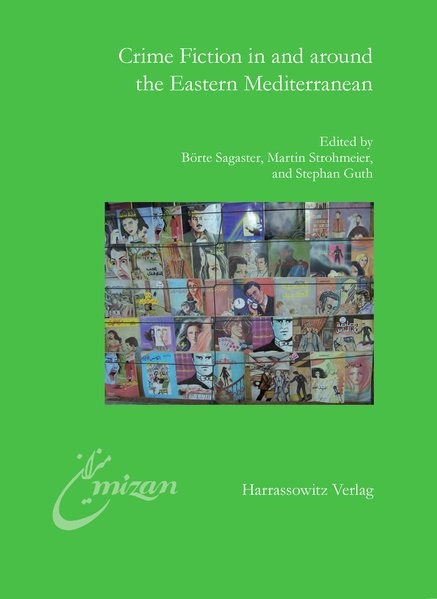
Sagaster, Boerte / Strohmeier, Martin / Guth, Stephan (Hg):
Crime Fiction in and around the Eastern Mediterranien.
2016, VII/156 S., Harrassowitz
Verlag (Mîzân – Studien zur Literatur in der islamischen Welt, Bd. 23), 3-447-10492-9 / 978-3-447-10492-0, EURO 39,00
For a long time, crime fiction has been considered popular literature – an assessment that prevented serious critical engagement with it. It is only in recent years that
critical literary theories have begun to be applied to genres such as crime fiction, while at the same time the interest of literary scholars in crime fiction by authors not belonging to the European-American ‘Western‘
cultures has grown. The articles assembled in this volume seek to address the role of crime fiction in and around the Eastern Mediterranean in countries such as Turkey, Greece, Morocco, Algeria, Syria, Saudi-Arabia, and Egypt,
focusing on generic, terminological, literary critical, social, and cultural themes. The book is intended to be an invitation for literary scholars doing research on different literatures of the Eastern Mediterranean to compare
and discuss their results and to engage in further research in this field.
Inhalt:
Acknowledgments / Börte Sagaster & Martin Strohmeier: Introduction / Alessandra Bountempo: „Vertigo“ and „The Dove’s Necklace“ as Romans
Noirs. A Hypthesis on Arabic Crime Fiction / Silvia Tellenbach: Law, Crime, and Society in the Middle East / Jonathan Smolin: Lies and Deceptions. „Saint Janjah“, Social Critique, and the New Arabic Police Novel
/ Roger Celestin: Post-Colonial Slumming Angels. Driss Chraïbi’s Inspector Ali and Yasmina Khadra’s Commissaire Llob / Stephan Guth: Thus Ruled the Court („Hukm al-‘adāla“). A Collection
of True Criminal Cases from Syria Turned into Narratives / Panagiotis Agapitos: Bloody metalanguage? Crime fiction in Greece, 1991-2011 / Wolfgang E. Scharlipp: Subgenres in Turkish Crime Fiction / Zeynep Tüfekçioğlu:
Let’s Say a Little about What’s There. Contemporary Turkish Crime Fictin and Its Literary Criticism / Karin Schweißgut: Religious Themes in Contemporary Turkish Crime Literature / Börte Sagaster: Cyprus
as A Crime Scene. Paris Aristides‘ „The Viper’s Kiss“ and Hasan Doğan’s „Murder on the Lost Island“ / Notes on Contributors.
(vt) KTS 71
|
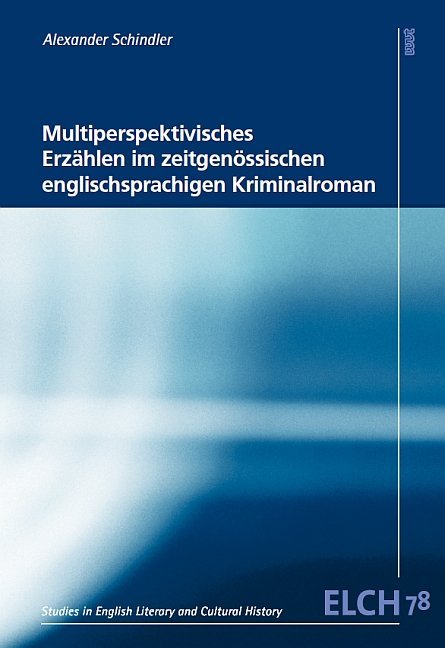
Schindler, Alexander:
Multiperspektivisches Erzählen im zeitgenössischen englischsprachigen Kriminalroman.
2020, 354 S., 1 Abbildung,
WVT – Wissenschaftlicher Verlag Trier (ELCH/ELK – Studies in English Literary and Cultural History/Studien zur Englischen Literatur- und Kulturwissenschaft, Bd. 78), 3-86821-865-3 / 978-3-86821-865-7, EURO 43,50
Sorgte bis zum Ende des ersten Drittels des vergangenen Jahrhunderts ein Regelwerk für ein festes Korsett bei der Erzählweise in der Kriminalliteratur, so änderten
sich diese narrativen Strukuren mit dem Ende des WK II. „Multiperspektivität“ hielt langsam Einzug in ein Genre, das weltweit als die populärste Literaturgattung an sich gilt. Dazu kam, dass man sich
immer häufiger der Kriminalliteratur wissenschaftlich näherte. Inzwischen gibt es eine fast nicht mehr zu überblickende Anzahl literaturwissenschaftlicher Analysen zum Genre. Alexander Schindler hat sich in
der vorliegenden Untersuchung ausführlich mit dieser „Multiperspektivtät“ der kriminalliterarischen Darstellung beschäftigt. Fünf ausschlaggebende Eckpunkte stellt der Autor für die zeitgenössische
Kriminalliteratur fest: „Spannungserzeugung, possible worlds theory, narrative Autorität, unzuverlässiges Erzählen und unreliable focalization“. Für seine Untersuchung hat Alexander Schindler
neunundzwanzig Primärwerke aus den unterschiedlichen Subgenres der englischsprachigen Kriminalliteratur begutachtet (forensische, historische, feministische Krimis, Polizeikrimis, Serienmörder-Krimis, klassische
Rätselkrimis). Die ausgewählten Werke dieser populären 29 britischen oder US-amerikanischen Autorinnen und Autoren, allesamt aus der ersten Riege der Gattung, machen u.a. den Reiz dieser lesenswerten Analyse
aus. Das Werk ist in einen „Theoretischen Teil“ und einen „Textanalytischen Teil“ geglieder. Die abschließende Bibliographie der Sekundärliteratur umfasst 33 Seiten! Der Leser wird hier bestimmt
wohl die ein oder andere interessante und vertiefende Veröffentlichung entdecken können.
Inhalt:
--- Einleitung / Forschungsgegenstand und Problemstellung / Stand der Forschung: Der zeitgenössische Kriminalroman / Aufbau der Studie: Zielsetzung, Vorgehensweise und Textauswahl.
--- Theoretischer Teil:
Entwicklung theoretischer Grundlagen für die Analyse multiperspektivischen Erzählens im zeitgenössischen Kriminalroman / Multiperspektivität aus Sicht der Narratologie,
possible worlds theory und Gender Studies (Multipersktivität und Narratologie / Multiperspektivität und possible worlds theory / Multiperspektivität und Gender Studies / Multiperspektivität und Spannung) / Textuelle Strategien zur Herausbildung von narrativer Autorität
erzählerischer und figuraler Perspektivträger / Unzuverlässigkeit im Kriminalroman.
--- Textanalytischer Teil:
Multiperspektivität und Spannung
Perspektivische Auffächerung und Rätselspannung in Robin Paiges „Death at Rottingdean“ (1999) / Flexible Spannungsmuster in Iain Pears‘ „Death
an Restoration“ (1996), Lisa Gardners „Live To Tell“ (2010) und Jefferson Bass‘ „Cut to the Bone“ (2013).
Multipersektivität und Autorität
Zentrierte Autorität in Patricia Cornwells „Trace“ (2004) / Variable Autorität in Karin Slaughters „Blindsighted“ (2001), James Pattersons „Kiss
the Girls“ (1995) und Victoria Thompsons „Murder on Bank Street“ (2008)
Multiperspektiviät und possible worlds theory
Konfligierende Welten und Gender in Sue Graftons „S is for Silence“ (2005) / „We come from different worlds“: Disparate Weltensysteme in Ann Cleeves‘
„Red Bones“ (2009), Peter James‘ „Dead Simple“ (2005) und Emily Winslows „The Whole World“ (2010)
Multiperspktivität und unreliable narration
„The reader is only informed of what the writers wishes him to know“: Unzuverlässige Erzählstimmen in Iain Pears‘ „An Instance of the Fingerpost“
(1997) / „Time […] for a little judicious tweaking of the truth“: Unglaubwürdige Vermittlungsinstanzen in Val McDermids „Trick of the Dark“ (2010), Minette Walters‘ „The Shape
of Snakes“ (2000) und Angela Marsons „Silent Scream“ (2015)
Multiperspktivität und unreliable focalization
Unzuverlässige Gedanken und fehlerhafte Wahrnehmung in Kate Atkinsons „One Good Turn“ (2006) / „[T]he truth was very different“: Multiple unzuverlässige
Fokalisierung in Caroline Grahams „A Place of Safety“ (1999), Ann Cleeves‘ „Hidden Depths“ /2007) und M.J. Arlidges „Little Boy Blue“ (2016)
--- Schlussbetrachtung: Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick
--- Literaturverzeichnis / Primärliteratur / Sekundärliteratur.
(tp) KTS 71
|
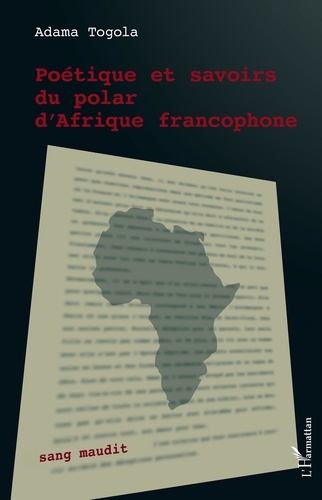
Togola, Adama:
Poétique et savoirs du polar d’Afrique francophone.
2020, 254 S., Éditions l’Harmattan (sang maudit),
2-343-20854-9 / 978-2-343-20854-1, EURO 27,00
Fragen nach der Beziehung des Krimis und Thrillers des französischsprachigen Afrikas zur Geschichte und Tradition des Genres, werden gewisse Regeln des Genres eingehalten,
sind diese Regeln erkennbar? Diesen Fragen geht Adama Togola in 25 Kapiteln seiner Untersuchung, basierend auf zahlreichen Kriminalromanen aus dem frankophonen Afrika, nach. Eine umfangreiche Bibliographie weiterführender
Literatur beschließt diese Analyse.
Adama Togola promovierte in französischer Literatur an der Universität von Montreal. Seine Forschungsschwerpunkte: französischsprachige
Literatur, Kriminalliteratur, Genre-Poetik.
(tp) KTS 71
|
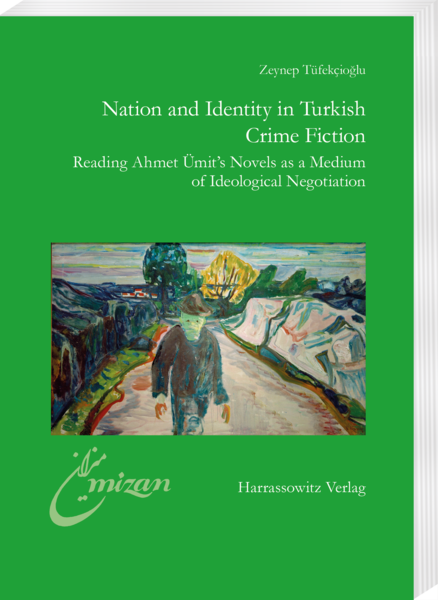
Tüfekçioğlu, Zeynep:
Nation and Identity in Turkish Crime Fiction. Reading Ahmet Ümit’s Novels as a Medium of Ideological
Negotiation.
2021, X/243 S., Harrassowitz Verlag (Mîzân – Studien zur Literatur in der islamischen Welt, Bd. 33), 3-447-11578-5 / 978-3-447-11578-0, EURO 58,00
Best known for his crime fiction, Ahmet Ümit is among the most celebrated and profilic writers of contemporary Turkish literature. Yet despite its popularity in Turkey, and
increasing recognition abroad, Ümit’s fiction has seldom been subject to scholarly inquiry. Adopting the framework of cultural narratology, Nation and Identity in Turkish Crime Fiction provides the most comprehensive
analysis to date of Ahmet Ümit’s crime novels, seeking thereby to fill a gap, and also to widen our understanding of the politics of the Turkish novel by extending the focus of literary and cultural dynamics that
have marked Turkish culture and politics over the last two decades. Zeynep Tüfekçioğlu conceptualizes Ümit’s fiction as a medium of ideological negotiation. The study unveils the significance of
the various narrative techniques, literary tropes and themes found in Ümit’s fiction, which he employs to contest dominant discourses of national identity, history, and cultural memory. Tüfekçioğlu
shows that since his early novels, Ahmet Ümit has been following and adopting the global trends in the genre, while also appropriating and subverting them for the purposes of cultural resistance. As such, this book will
appeal to scholars of Turkish literary and cultural studies, as well as to scholars and devoted readers of crime fiction.
Inhalt:
--- Acknowledgments / Note on Editions, Spelling, and Transcriptions.
--- Introduction: From the Periphery to the Center? Contemporary Crime Fiction in Turkey / Aims, Main Research Questions, and Methods / Overview of the Chapters.
--- 1. Theoretical and Methodological Premises (Interconnections Between the Theoretical and Methodological Approaches and Aims of this Study / Cultural Narratology. A Possible
Modus Operandi for the Study of Turkish Literature / A Note on Key Concepts).
--- 2. Positioning Ahmet Ümit in the Post-1980 Turkish Literary Field (Becoming the Author of Turkish Crime Fiction / Ahmet Ümit’s Narratives as a Cultural Way of Self- und Worldmaking until the Gezi Revolt / Ehe End of His Ambivalent Politics
of Resistance. The Aftermath of the Gezi Protests / Chapter Conclusion).
--- 3. Beginnings: Reading Ümit’s Early Works as Political Thrillers (Narratives of Broken Masculinities and Popular Manifestions of Homo Secularis / Uncovering the Discontents of the (Deep) State. The Fog and the Night, The Scent of Snow, and The Marionette / Debunking the Genocide Taboo and dhe Military Myth. Patasana / Chapter Conclusion).
--- 4. Transitions: Religion and History in Ümit’s Post-secular Novels (Towards Post-secularism / Religious Identities and Religiosities in Beyoglu Rhapsody and The Man who Spoke the Languages of Jesus / A Contemporary Sufi Tale. The Dervish Gate / Chapter Conclusion).
--- 5. Transgressions: Alternative Histories in Ümit’s Istanbul Novels (Neo-Ottomanism vs. Ottomania. Reimagining the Ottoman Legacy / Nostalgia for the Past. Istanbul
Cosmopolitanism in A Memento for Istanbul / Postmodernist Contestation of National Historiography in To Kill a Sultan / Chapter Conclusion).
--- Conclusion / References.
Die Fachgebiete von Frau Dr. Zeynept Tüfekçioğlu (Universität Duisburg-Essen) sind u.a. moderne türkische Literatur, Genealogie des türkischen Romans,
Islam und Sufismus in der türkischen Literatur, Kriminalroman und Populärkultur.
https://www.uni-due.de/turkistik/zeynep_tuefekcioglu.php
https://www.due.de/imperia/md/content/turkistik/zeynep_tüfekcioglu_cv.pdf
(vt) KTS 71
Autorenporträts
Autobiographien
Biographien
Werkschau
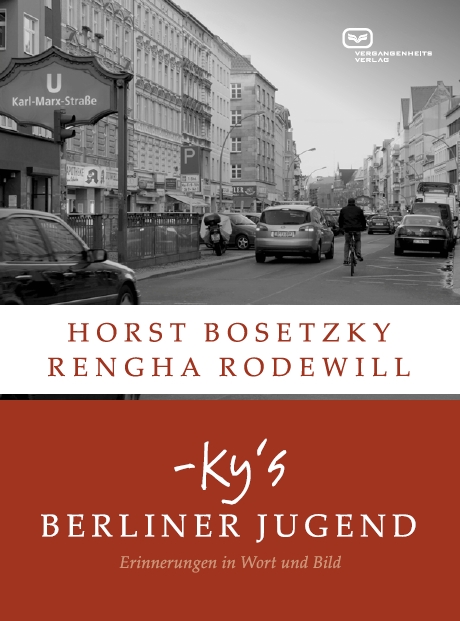
Bosetzky, Horst / Rodewill, Rengha:
-ky’s Berliner Jugend. Erinnerungen in Wort und Bild.
2014, 200 S., zahlreiche Fotos, Vergangenheits
Verlag, 3-86408-173-4 / 978-3-86408-173-6, EURO 14,99
Horst Bosetzky (1.2.1938 – 16.9.2018) schrieb zwischen 1971 und 2019 (posthume Veröffentlichung) unter dem Pseudonym –ky 62 Kriminalromane, Kriminalstories, eine
umfangreiche Familiensage, Kinder- und Jugendromane und unter den Pseudonymen John Drake und John Taylor etliche Heftromane. –ky wurde in Berlin-Köpenick geboren und wuchs in Berlin-Neukölln auf. Erst am 1.4.1981
lüftete –ky sein Pseudonym, und zwar zur Premiere der Verfilmung seines Kriminalromans „Kein Reihenhaus für Robin Hood“. Zusammen mit der Fotografin Rengha Rodewill präsentierte er 2014 seine
Erinnerungen und seine Erinnerungsorte in. „–ky’s Berliner Jugend“ ist (s)eine nostalgische Reise durch Berlin-Neukölln der Nachkriegszeit und gleichzeitig eine „Geschichsstunde mit –ky“.
Illustriert werden seine Erinnerungen durch historischen Fotografien, ergänzt mit zahlreichen Bilder der bekannten Fotografin Rengha Rodewill.
Inhalt:
Warum dieses Buch mit –ky? / Warum dieses Buch? / Ossastraße / Rütli-Schule / Albert-Schweitzer-Schule / Rede zum Festakt 100 Jahre Albert-Schweitzer-Schule /
Meine Straßen / Straßenbahn & S-Bahn / Kinos / U-Bahnhof Rathaus Neukölln / Karl-Marx-Straße / Rathaus Neukölln / Ganghoferbad / Hermannplatz & Hasenheide / Kneipen / Fußball &
Flughafen Tempelhof / Kreuzberg / Neuköllner Schifffahrtskanal / Schmöckwitz, Köpenick, Grünau / Es geschah in Neukölln / Impressionen / Biografie Rengha Rodewill / Biografie Horst Bosetzky / Fotonachweise.
Horst Bosetzky / -ky wurde am 1.2.1938 in Berlin-Köpenick geboren. Er gilt als Begründer des sogenannten „Sozio-Krimis“
und war neben Hansjörg Martin, Richard Hey und Michael Molsner verantwortlich für den „Neuen deutschen Kriminalroman“. Der Soziologe und Schriftsteller Horst Bosetzky verstarb am 16.9.2018 in Berlin.
Rengha Rodewill, geboren in Hagen/Westfalen, lebt in Berlin, arbeitet als Malerin und Fotografin.
www.rengha-rodewill.com
(tp) KTS 71
„8 Fragen an Horst Bosetzky / -ky“ siehe KTP 123 & KTS 66
*****
Weiterführende Literatur zu –ky im BoKAS:
--- Bayer, Irene: Juristen und Kriminalbeamte als Autoren des neuen deutschen Kriminalromans: Berufserfahrung ohne Folgen? Ein Vergleich der Kriminalromane des Juristen Fred
Breinersdorfer, des Juristen Stefan Murr und des Kriminalbeamten Dieter Schenk mit den Kriminalromanen der Autoren Richard Hey, Felix Huby, -ky und Friedhelm Werremener. 1989, P. Lang Verlag
--- Bodmann, Anja: Gesellschaftsdarstellung und Sozialkritik in deutscher Kriminalliteratur der Gegenwart am Beispiel der Autoren Richard Hey, -ky und Hansjörg Martin.
1995, Universität Vechta
--- Brönnimann, Jürg: Der Soziokriminalroman. Ein neues Genre oder ein soziologischesn Experiment? Eine Untersuchung des Soziokriminalromans anhand der Werke der
schwedischen Autoren Mai Sjöwall und Per Walhöö und des deutschen Autors –ky. 2001, Massey University
--- Brönnimann, Jürg: Der Soziokrimi. Ein neues Genre oder ein soziologischesn Experiment? Eine Untersuchung des Soziokriminalromans anhand der Werke der schwedischen
Autoren Sjöwall und Wahlhöö und des deutschen Autors –ky. 2004, NordPark Verlag
--- Dornseiff-Allgeier, Sibylle: Der moderne deutsche Kriminalroman. Analysen zu Friedhelm Werremeier, Hansjörg Martin, Irene Rodrian und –ky. 1980, Universität
Heddesheim
--- Hüne, Peter (Hg): Zwischen Bramme und Berlin. (Horst Bosetz)-ky zum 60. Geburtstag. 1968, Jaron Verlag
--- Kümmel, F.-Michael: Gesellschaftliche Widerspiegelung im bundesdeutschen Kriminalroman nach 1968, dargestellt an ausgewählten Beispielen. 1981, Universität
Münster
--- Moschner, Martina: Der „Sozio-Krimi“. Eine Analyse von –kys Detektivromanen. 1985, Universität Köln
--- Rausch, Susanne G.: Gibt es einen „neuen deutschen Kriminalroman“? Zum Verhältnis von Struktur und Gattungstradition im deutschen Kriminalroman nach 1970.
1990, Universität Berlin
--- Rühl, Christina: Jenseits von Schuld und Sühne. Literatursoziologisch-kriminologische Aspekte ausgewählter Kriminalliteratur. 2010, Universität Gießen
--- Runte, Werner: Die Darstellung von Großstadt und Provinz in ausgewählten Detektivromanen Simenons und –kys. 1991, Universität Köln
--- Schregelmann, Hans: Das Stereotyp (Bild) des Journalisten im deutschen Kriminalroman. 1983, Universität München
--- Thomas, Stefanie: Sendungsbewußtsein, Strukturformen und Wirkungstendenzen des Kriminalromans der achtziger Jahr. 1985, Universität Berlin
*****
|
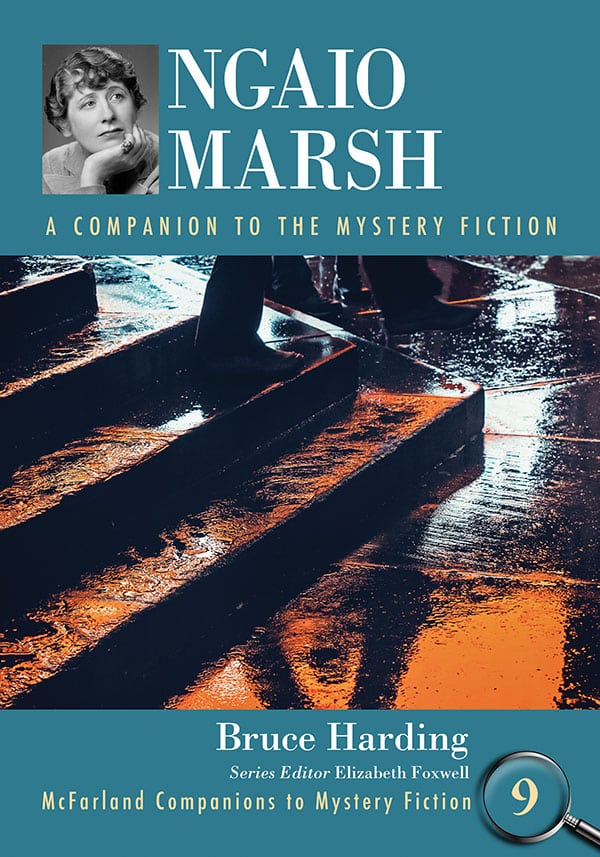
Harding, Bruce:
Ngaio Marsh. A Companion to the Mystery Fiction.
2019, 204 S., 14 s/w Fotos und Abbildungen, McFarland & Company (McFarland
Companions to Mystery Fiction, Bd. 9), 0-7864-6032-6 / 978-0-7854-6032-8, US $ 49,95
Auch auf die Gefahr hin, die Bezieher des KTS zu langweilen: Es ist mir stets eine Freude auf die Reihe „McFarland Companions to Mystery Fiction“ hinzuweisen. Die Reihe
ist durch die Bank hervorragend gemacht und bietet als Begleitmaterial zur jeweiligen Autorin / zum jeweiligen Autor vielschichtiges Informationsmaterial. Band 9 der Reihe beschäftigt sich mit der neuseeländischen
Autorin und Theaterdramaturgin Ngaio Marsh (23.4.1895 – 18.2.1982). Ngaio Marsh hinterläst ein umfangreiches Werk sowohl an Kriminalliteratur wie auch an Theaterstücken. Nach Vollendung ihres 32sten Krimis
(„Light Thickens“) verstarb Ngaio Marsh im Februar 1982. 1966 wurde sie zur Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (kurz Dame of the British Empire, DBE) erhoben. Ihre Geburtsstadt Christchurch
hat ihr mit dem Ngaio Marsh House, dessen Kurator Bruce Harding ist, als Erinnerungsstätte ein Denkmal gesetzt. Ein ausführliches Interview in zwei Teilen (7.4.1978 & 24.4.1978), sowie eine überaus umfangreiche
kommentierte Bibliographie weiterführender Literatur und ein Index beschließen dieses äußerst zu empfehlende Nachschlagewerk.
Inhalt:
Acknowledgments / Preface / Organization of the Companion / Marsh’s Works in Chronological Order / Marsh’s Works in Alphabetical Order / A Brief Biography / A Career
Chronology / The Companion / Interviews with Dame Ngaio Marsh / Annotated Bibliography / Index.
Bruce Harding ist Kurator des Ngaio marsh House in Christchurch/Neuseeland und Vositzender des English Departments an der University of Canterbury
in Christchurch.
(tp) KTS 71
Weiterführende Literatur zu Ngaio Marsh im BoKAS:
--- Drayton, Joanne: Ngaio Marsh. Her Life in Crime. 2009, HarperCollins
--- Gibbs, Roman / William, Richard (Hg): Ngaio Marsh. A Bibliography of English Languages Publications in Hardback and Paperback With a Guide to the Value of the First Editions.
1990, Dragonby Press
--- Pützstück. Lothar: Das Bild des Fremden im Detektivroman mit völkerkundlichem Inhalt. Ein Beitrag zur Diskussion „Anthropology in Fiction“ anhand
ozeanischer Beispile. 1988, Holos
--- Rahn, B.J.: Ngaio Marsh. The Woman and Her Work. 1995, The Scarcrow Press
*****
|
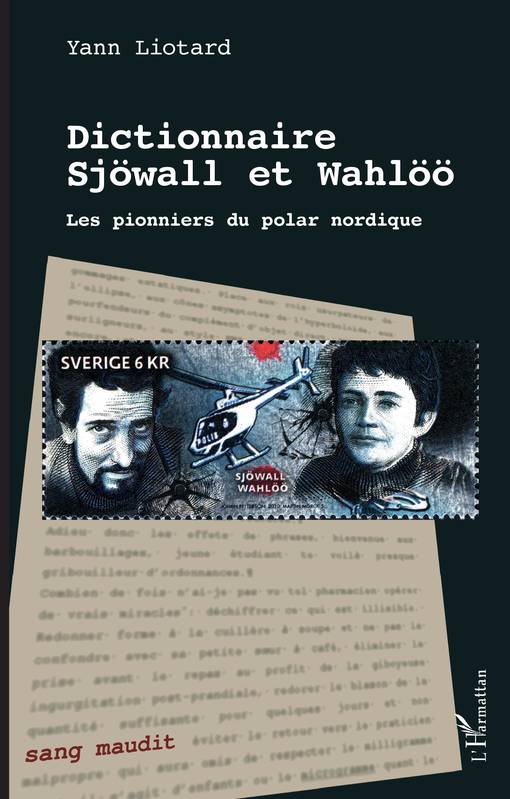
Liotard, Yann:
Dictionnaire Sjöwall et Wahlöö.
Les prioniers du polar nordique.
2020, 199 S., Éditions L’Harmattan
(sang maudit), 2-343-20700-3 / 978-2-343-20700-1, EURO 18,00
In den 1960er Jahren betrat Kommissar Martin Beck die schwedische Krimiszene. Ersonnen wurde er vom Duo Mai Sjöwall und Per Wahlöö. In insgesamt 10 Bänden konnte
man seine Ermittlungsarbeit und sein Abarbeiten am schwedischen Staat verfolgen. Sjöwall / Wahlöö läuteten mit ihrer Martin Beck-Serie eine Wende ein, sowohl in der der skandinavischen wie auch der (west-)europäischen
Kriminalliteratur. Ohne das Autorenduo als Vorbild wären ihre Nachfolger wie z.B. Henning Mankell, Arnaldur Indridason, Åke Edwardson oder Stieg Larsson nicht so erfolgreich geworden. Auch auf die (west-)europäische
Kriminalliteratur haben die „Pioniere des nordischen Kriminalromans“ sehr erfolgreich Einfluß genommen. Yann Liotard bietet mit dem „Dictionnaire Sjöwall et Wahlöö“ ein kleines
Nachschlagewerk an, das auf jedes mögliche Stichwort im Umkreis des Autoren-Duos eine Antwort zu geben versucht. In 500 alphabetisch geordneten „articles“, gemeint sind allerdings (meist nur) kurze Eintragungen
und Erläuterungen (wie hätten auch sonst 500 Artikel Platz auf den insgesamt 199 Seiten?!)– ab und an mit Zitaten abgerundet - breitet Liotard die Krimi-Welt um Sjöwall / Wahlhöö aus. Als gepriesenes
Nachschlagewerk stellt der Benutzer dieses „Dictionnaire“ etwas ratlos und enttäuscht ins Regal zurück.
Yann Liotard ist Professor für klassische Literatur an der Universität Grenoble.
(tp) KTS 71
|
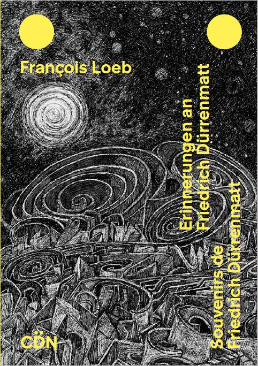
Loeb, François:
Erinnerungen an Friedrich Dürrenmatt / Souvenirs de Friedrich Dürrenmatt.
2019, 64 S., 2 Abbildungen, Centre
Dürrenmatt Neuchâtel – CDN (Cahier du CDN 22), 2-9701282-1-7 / 978-2-9701282-1-2, CHF 8,00
Seine erste Begegnung mit dem Schweizer Großdichter und -dramatiker Friedrich Dürrenmatt (5.1.1921 – 14.12.1990) hatte François Loeb 1976, als er Dürrenmatt
in dessen Stammrestaurant „Du Rocher“ in Neuchâtel traf, um ihn zu einer Reise nach Jerusalem zu überreden. Dort sollte Dürrenmatt 1977 der Ehrendoktor der Hebräischen Universität Jerusalem
verliehen werden. Dieses erste Treffen und „Arbeitsessen“ der beiden Männer mündete letztendlich in eine Freundschaft. In den zweisprachigen „Erinnerungen an Friedrich Dürrenmatt“ lässt
François Loeb wichtige wie auch skurrile Begebenheiten aus dem Leben des Lebemannes - gutes Essen und erstklassiger Wein standen bei Dürrenmatt immer an erster Stelle - , der stets einen Hang zu Dramatik und Ironie
hatte, aber auch sehr großzügig und hilfsbereit war, Revue passieren.
Inhalt:
Madeleine Betschart: Vorwort / Préface.
François Loeb: Erinnerungen an Friedrich Dürrenmatt / Souvenirs de Friedrich Dürrenmatt.
François Loeb, geboren und aufgewachsen in Bern. Mit Friedrich Dürrenmatt war François Loeb
ab Mitte der 1970er Jahre freundschaftlich verbunden. Als langjähriger Freund und Nationalrat (1987-1999) setzte er sich maßgeblich für die Gründung des Centre Dürrenmatt Neuchâtel ein. Veröffentlichungen
unter dem Pseudonym Bruno A. Nauser in der Wochenendausgabe der „Neuen Zürcher Zeitung“, spätere Veröffentlichungen unter seinem richtigen Namen.
www.francois.loeb.com
Madeleine Betschart, Kunsthistorikerin und Archäologin, leitet seit 2014 das Centre Dürrenmatt Neuchâtel.
Davor war sie stellvertretende Direktorin der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia in Zürich. Zudem hat sie das Alimentarium in Vevey und das Museum Schwab in Biel geleitet.
www.cdn.ch/cdn/de/home/centre/organisation.html
(tp) KTS 71
|
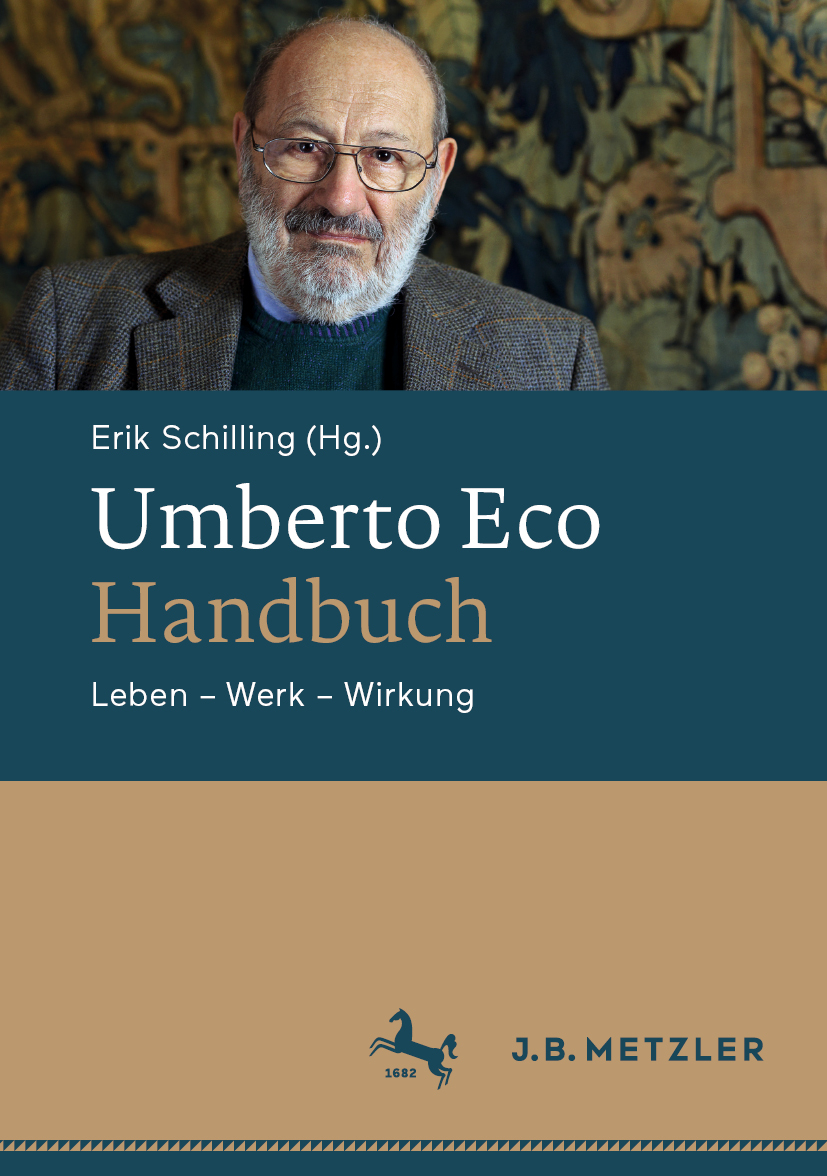
Schilling, Erik (Hg): Umberto Eco-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. 2021, VIII/395 S., Verlag J.B. Metzler (Springer), 3-476-05779-8
/ 978-3-476-05779-2, EURO 99,99
Umberto Eco war einer der wichtigsten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Mit „Der Name der Rose“ wurde er einem Weltpublikum bekannt, danach blieb er mit sechs weiteren
Romanen sowie zahllosen Essays, Interviews und Zeitschriftenkolumnen präsent. Einen Namen gemacht hatte sich Eco jedoch bereits mit theoretischen Texten, u.a. seinem kontrovers diskutierten „Offenen Kunstwerk“
sowie seinen Schriften zur Semiotik. Auch als Schriftsteller blieb Eco zeitlebens Literatur- und Kulturkritiker; bei kaum einem weiteren Autor des 20. Jahrhunderts ist das theoretische und literarische Schaffen ähnlich
stark verknüpft. Das Umberto Eco-Handbuch bietet einen Wegweiser in alle Aspekte von Ecos vielfältigem Wirken. Dazu bietet es einerseits Übersichtskapitel zu allen theoretischen und literarischen Schriften Ecos,
andererseits systematische Beiträge, die vielfältige Querbezüge aufzeigen, etwa zwischen Geschichte und Gegenwart, Semiotik und Kriminalroman, historischem Erzählen und Postmoderne.
Inhalt:
Thomas Stauder: Biographische Skizze / Klaus Birnstiel: Diskursive Kontexte / Thomas Stauder: Rezeption / Burkhart Kroebe: Eco übersetzen – Erfahrungen aus drei Jahrzehnten
/ Dieter Miersch: Das offene Kunstwerk (Opera aperta) / Winfried Noth: Frühe semiotische Schriften / Armin Burkhardt: Spätere Schriften zur Semiotik und Sprachphilosophie / Zeno Bampi: Wie man eine wissenschaftliche
Abschlußarbeit schreibt (Come si fa una tesi di laurea) / Helge Schalk: Schriften zur Interpretationstheorie / Holger Siever: Textkritik und Übersetzen / Erik Schilling: Der Name der Rose (Il nome della rosa) /
Katrin Max: Das Foucaultsche Pendel (Il pendolo di Foucault) / Günter Berger; Die Insel des vorigen Tages (L’isola del giomo prima) / Susanne Friede: Baudolino / Monika Schmitz-Emans: Die geheimisvolle Flamme der
Königin Loana (La misteriosa flamma della regina Loana) / Susanne Kleinert: Der Friedhof in Prag (Il cimetero di Praga) / Julia Ilgner: Nullnummer (Numero zero) / Michèle Mattusch: Erzählungen/Essays / Cornelia
Remi: Kinderbücher / Angela Oster: Schriften zur Ästhetik / Erik Schilling: Schriften zur Medientheorie / Antonio Roselli: Schriften zur Politik und Zeitgeschehen / Magdalena Specht: Abduktion(sprozesse) / Grit Fröhlich:
Ästhetik / Thomas Stauder: Autofiktion / Dirk Werle: Bibliothek / Rabea Conrad: Gender / Jörg Schwarz: Geschichte / Erik Schilling: Historisches Erzählen / Grit Fröhlich: Interpretation / Eva Contzen: Liste
/ Erik Schilling: Literatur/Theorie / Armin Burkhardt: Metapher / Jörg Schwarz: Mittelalter / Cosima Linke: Musik / Nadine Popst: Philosophie im Roman / Erik Schilling: Populärkulturelle Rezeption / Erik Schilling:
Populismus/“Urfaschismus“ / Erik Schilling: Postmoderne / Oster Angela: Renaissance/Barock / Jürgen Trabant: Semiologie/Semiotik/Sematologie / Reinhard M. Möller: Serendipität / Erik Schilling: Sprache
und Sein / Thomas Stauder: Tod / Susanne Kleinert: Verschwörungstheorien / Armin Burkhardt: Zeichen / Julia Ilgner: Zeitung / Bibliographien, Werkverzeichnis, Register.
Erik Schilling ist Privatdozent für Neuere Deutsche Literatur und Vergleichende Literaturwissenschaft an der LMU München. Er studierte deutsche, lateinische und italienische
Philologie in München, Pavia und Salamanca und wurde in München und Stanford mit einer Arbeit zu Umberto Eco und dem historischen Roman promoviert.
https://www.germanistik.uni-muenchen.de/personal/ndl/mitarbeiter/schilling/index.html
(vt) KTS 71
|
Film
TV
Hörspiel
Theater

Behmel, Albrecht / Brauch, Elisabeth:
Lexikon der Filmschurken.
Killer, Monster und Gegenspieler aus hundert Jahren Film- und Fernsehgeschichte.
2020, 852 S., ibidem Verlag, 3-8382-0968-0 / 978-3-8382-0968-5, EURO 89,90
Welche Archetypen von Bösewichtern gibt es? Was haben Finsterlinge aus modernen Hollywood-Blockbustern mit uralten Monstern der Antike zu tun? Wie werden aus Schurken manchmal
Helden, und warum müssen auch Freunde immer wieder Gegenspieler sein? Albrecht Behmel und Elisabeth Brauch haben Verbrecher, Gauner, Monster und Gegenspieler aus den frühen Jahren der Stummfilmzeit (1912) bis ins
neue Jahrtausend (2012) hinein gesammelt, geordnet und in eine übersichtliche Bewertungsmatrix gebracht, die es Stoffentwicklern, Produzenten und Regisseuren, aber auch Schauspielern und Game Designer erlaubt, ihr Wissen
über das Böse im Bewegtbild klug zu systematisieren und Gemeinsamkeiten sowie Entwicklungsstränge zu identifizieren. Damit leistet dieses Lexikon nicht nur einen Beitrag zur wissenschaftlichen Erfoschung der
Frage, wie und wohin sich das Konzept des Antagonisten entwickelte, es ist auch eine kleine Kulturgeschichte der dunklen Mächte in Katalogform entstanden, die erstaunliche Brücken zwischen den Genres, Verwandtschaften
und Inspirationen der Charakterentwicklung von Gestalten wie Darth Vader, Mephisto, dem großen weißen Hai und anderen ikonischen Figuren des populären Films offen legt.
Inhalt:
--- Vorwort / Einleitung.
--- Teil 1: Geschichten.
Was sind Geschichten? / Geschichten und Macht / Perspektive, Umfang und Konflikt / Literarische Figuren und ihre Realität / Geschichten im Film / Genre / Antagonisten / Stereotypische
Elemente / Das Böse / Vom Anteil der Helden am Bösen / Natur und Technik / Asymmetrische Antagonisten / Eine Matrix für Antagonisten / Archetypen von Antagonisten [Gegenpart / Aussehen / Verhalten / Know-how
/ Waffen / Gewaltbereitschaft / Motiv / Konfrontationsform / 1. Unversöhnlich / 2. Vom Freund zum Feind / 3. Vom Feind zum Freund / Verbündete / Täuschung / Schwachpunkt / Schuld / Fehler / Ende / Markenzeichen].
--- Teil 2: Filmevolution.
Antagonisten gegen Protagonisten / Film und Antagonisten bis 1929 / Film und Antagonisten der Dreißiger und Vierziger Jahre / Film und Antagonisten der Fünfziger und
Sechziger Jahre / Film und Antagonisten der Siebziger Jahre / Film und Antagonisten der Achtziger und Neunziger Jahre / Film und Antagonisten von 2000 bis 2012 / Aus Monstern werden Helden [Werwölfe / Vampire / Künstliche
Kreaturen / Riesen / Drachen / Hexen / Zauberer / Meuchelmörder / Geister / Dämonen / Mutanten / Außerirdische].
--- Teil 3: Lexikon.
Antagonisten bis 1929 / Antagonisten der 1930er / Antagonisten der 1940er / Antagonisten der 1950er / Antagonisten der 1960er / Antagonisten der 1970er / Antagonisten der 1980er
/ Antagonisten der 1990er / Antagonisten der 2000er / Antagonisten seit 2010.
--- Personen-, Figuren- und Sachindex / Filmographie / Bibliographie.
Albrecht Behmel hat in Heidelberg und Berlin Kunst, Geschichte und Philosophie studiert. Er hat zahlreiche Sachbücher
und Romane veröffentlicht und lebt und arbeitet im Schwarzwald.
Elisabeth Brauch hat sich auf die Mechanik und Wirkung von Storytelling spezialisiert. Sie liebt Geschichten,
die sie auf Reisen durch Fotografie oder bei einem Kaffee sammelt.
(vt) KTS 71
|
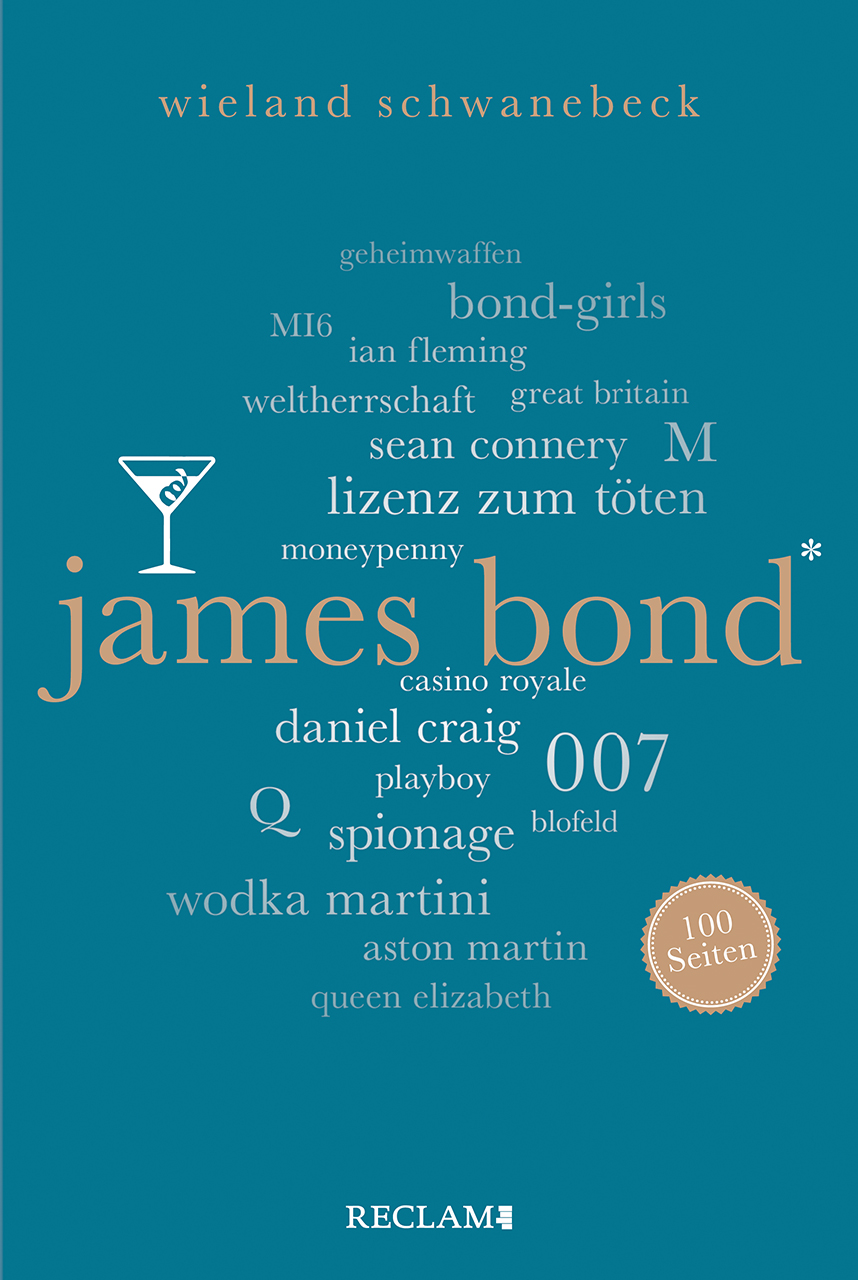
Schwanebeck, Wieland: James Bond. 2021, 100 S., 17 s/w Abbildungen, Tabellen und Grafiken, Reclam Verlag (100 Seiten), 3-15-020577-8 / 978-3-15-020577-8,
EURO 10,00
Der neue James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ ist angekündigt. Pandemiebedingt muss auf den Start des Filmes leider noch gewartet werden. Diese Wartezeit kann
man mit der Lektüre einer kleinen wie feinen Buchneuerscheinung aus der Reihe „100 Seiten“ des Reclam Verlages nutzen: „James Bond“ aus der Feder des Literaturwissenschaftlers Wieland Schwanebeck.
Es wird für den Leser eine vergnügliche Warte- und Lesezeit sein, um sich mit den wichtigsten Details von Ian Flemings James Bond und den entsprechenden Adaptionen für die große Leinwand zu beschäftigen.
In sieben Kapiteln, stilgerecht von 001 bis 007 durchdekliniert, und einer kleinen ergänzenden Aufstellung von Lektüretipps, zeichnet Schwanebeck den Kosmos des Weltenretters und Liebhabers vieler attraktiven Damen
nach.
Inhalt:
001 Prolog / 002 Sein Name sei Bond / 003 „Ich brauch jetzt mal einen richtigen Mann“ / 004 Kiss-Kiss / 005 Herren und Knechte / 006 Der Botschafter von der Insel /
007 „Hobbys?“ – „Auferstehung!“ / Lektüretipps (Zur Entstehung und Geschichte der James-Bond-Reihe & Kulturwissenschaftliche und politische Analysen des James-Bond-Phänomens).
Wieland Schwanebeck, geboren 1984, ist als anglistischer Literatur- und Kulturwissenschaftler an der TU Dresden tätig. Er lehrt und forscht
u.a. zu Männlichkeit, Hochstapelei, Humor und britischer Filmgeschichte. Zuletzt hat er eine Literaturgeschichte des Zwillings, „Literary Twinship from Shakespeare to the Age of Cloning“ (2020), vorgelegt.
https://tu-dresden.academia.edu/WielandSchwanebeck
(tp) KTS 71
|
Kriminalistik
True Crime
Spionage
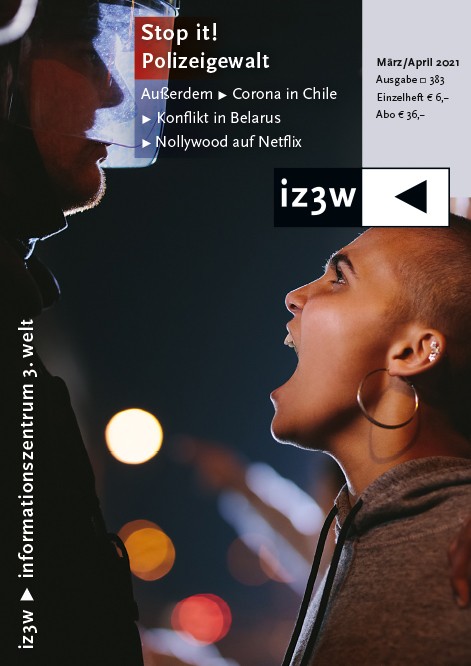
Aktion Dritte Welt e.V. / informationszentrum 3. welt [iz3w] (Hg):
Stop it! Polizeigewalt.
2021, 52 S., s/w Fotos, iz3w März/April 2021 (Ausgabe
383), ISSN 1614-0095, EURO 6,00
Das berühmteste/berüchtigste Beispiel für Polizeigewalt ist derzeit der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der am 25. Mai 2020 in Minneapolis bei seiner Festnahme
qualvoll zu Tode kam. Die Redaktion der Zeitschrift iz3w hat in 8 Artikeln einen kritischen Blick auf die Institution Polizei geworfen - oder um im kriminalen Jargon zu bleiben, eine „Observation“ vorgenommen.
Inhalt:
Redaktion: Man kann nicht sicher sein. Editorial zum Themenschwerpunkt. / Eric von Dömmning: Die ganze normale Gewalt. Polizeigewalt ist keine Ausnahme / ignite! Kollektiv
* : Nicht reformfähig. Kritik der und Alternativen zur Polizei / Winfried Rust: Cop Culture. Ein unversales Regime von Herrschaft / Christa Wichterich: Ein Ausbund toxischer Männlichkeit. Polizeigewalt in Indien
als autoritär-staatliches Instrument / Ute Weinmann: Postsowjetische Prügel. Die `Miliz´ agiert in Russland und Zentralasien mit Härte / Heinrich Bergstresser: Prekäre Polizei. Die Nigeria Police Force.
Gewaltakteur und Opfer von Gewalt / Ulrike Rainer: Von tödlicher Wahrscheinlichkeit. Rassismus und Polizeigewalt in den USA / Christian Jakob: „Menschenhändler verfolgen“. Menschen auf der Flucht fürchten
die Ordnungskräfte.
[* „ignete! ist ein Kollektiv, das zu feministischen und herrschaftsfeindlichen Themen Workshops gibt, schreibt und handelt“ (Red. iz3w)]
(tp) KTS 71
|
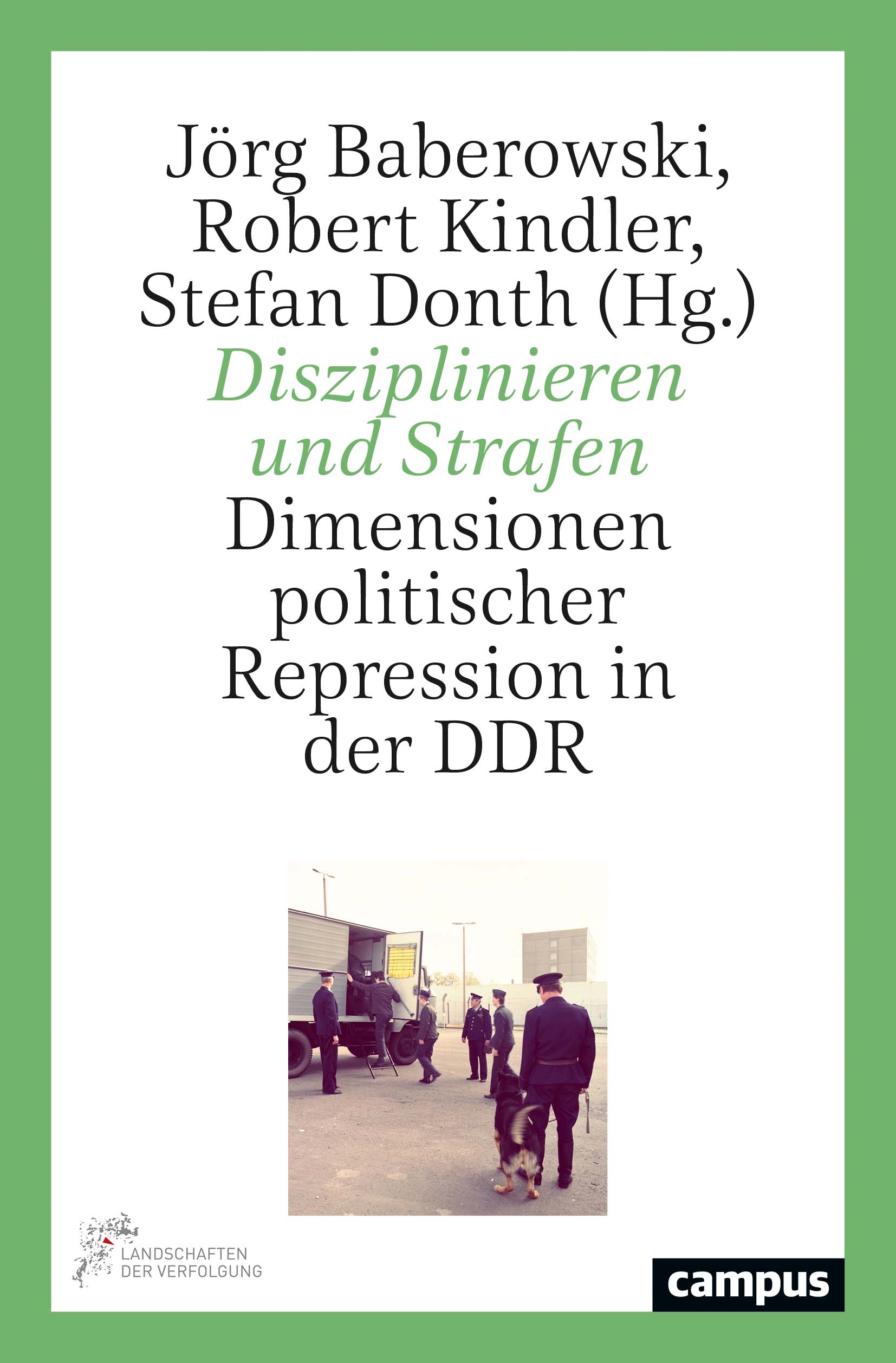
Baberowski, Jörg / Kindler, Robert / Donth, Stefan (Hg):
Diszplinieren und Strafen.
Dimensionen politischer Repression in der DDR.
2021,
348 S., Campus Verlag, 3-593-51327-7 / 978-3-593-51327-0, EURO 39,95
Alle sozialistischen Staaten setzten auf Repressionen, um tatsächliche und vermeintliche Gegner zu strafen, Renitenz zu unterbinden und die Bevölkerung zu disizplinieren.
Dazu bedienten sie sich eines breiten Arsenals an Praktiken, das von Folter und (Lager-)Haft bis hin zu psychischer „Zersetzung“ oder Kindesentzug reichte. Die Beiträge dieses Buches diskutieren Formen und
Folgen politischer Repression in der DDR und anderen sozialistischen Diktaturen. Sie zeigen, wie die Täter vorgingen und weshalb Rehabilitierung und Aufarbeitung auch drei Jahrzehnte nach dem Ende des Sozialismus nicht
an ihr Ende kommen können.
Inhalt:
--- Danksagung / Jörg Baberwoski & Robert Kindler: Disizplinieren und Strafen: Vom Leben mit der Diktatur.
--- I. Drohen und Strafen
Tobias Wunschik: Besserung durch „Rotlichtbestrahlung“? Konjunkturen im Erziehungsstrafvollzug der DDR 1949-1989 / Sebastian
Stude: Neben der Gesellschaft. „Rowdys“ und „Rowdytum“ in Potsdam 1968-1989 / Markus Mirschel: Gefühlte Repressionen. „Keine Nachsicht mit Verrätern“.
--- II. Disziplinieren und Erzhiehen
Christian Sachse: Die planmäßige Produktion von Gehorsam im Sozialismus. Techniken der Disziplinierung / Florian von Rosenberg & Carolin Wiethoff: Zuerst der Staat,
dann seine Kinder. Propaganda, Pädagogisierung und politische Repression im DDR-Krippensystem der 1950er und 1960er Jahre / Felicitas Söhner, Anne Oommen-Halbach, Karsten Laudien & Heiner Fangerau: Disziplinieren
durch strukturelle Gewalt in Kinderheimen in der DDR? Das Forschungspotential von Zeitzeugenberichten.
--- III. Bewältigen
Johannes Weberling: Aus der Geschichte (nichts) gelernt? Die juristische Aufarbeitung des SED-Regimes und die Rehabilitierung seiner Opfer / Konstantin Neumann: Zu Recht in Stasi-Haft?
Die Rehabilitierungsdebatte um fahnenflüchtige Soldaten der Nationalen Volksarmee / Agnès Arp & Ronald Gebauer: Gab es in der DDR politisch motivierte Adoptionen? Herausfordungen und Perspektiven der Forschung
/ Birgit Neumann-Becker: Unterstützung für SED-Verfolgte. Ein Praxisbericht der Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung / Julian Obenauer & Barbara Zehnpfennig: Konzepte des Gewissens und ihre
Anwendbarkeit auf das Leben in der Diktatur.
--- IV: Vergleichen
Samuel Kunze: Repression und Religion. Die Disziplinierung der christlichen Kirchen im Spätstalinismus / Uta Gerlant: Die Einen vernichten, die Anderen einschüchtern.
Disziplinieren durch Strafen in der späten Sowjetunion / Jonila Godole: Das Erbe der kommunistischen Diktatur in Albanien.
--- Abkürzungen / Quellen und Literatur / Autorinnen und Autoren.
Jörg Baberowski ist Professor für Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität zu Berlin.
https://www.geschichte.hu-berlin.de/de/bereiche-und-lehrstuehle/geosteuropas/geschichte-osteuropas-1/personen/1683840
Robert Kindler, Dr. phil., ist Osteuropahistoriker an der Humboldt-Universität zu Berlin und wissenschaftlicher
Koordinator des BMBF-Forschungsverbunds „Landschaft der Verfolgung“.
https://www.geschichte.hu-berlin.de/de/bereiche-und-lehrstuehle/geosteuropas/geschichte-osteuropas-1/personen/1681987
Stefan Donth, Dr. phil., arbeitet in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen und ist stellvertretender
Sprecher des BMBF-Forschungsverbunds „Land der Verfolgung“.
https://landschaften-verfolgung.de/personen/dr-stefan-donth/
(vt) KTS 71
|
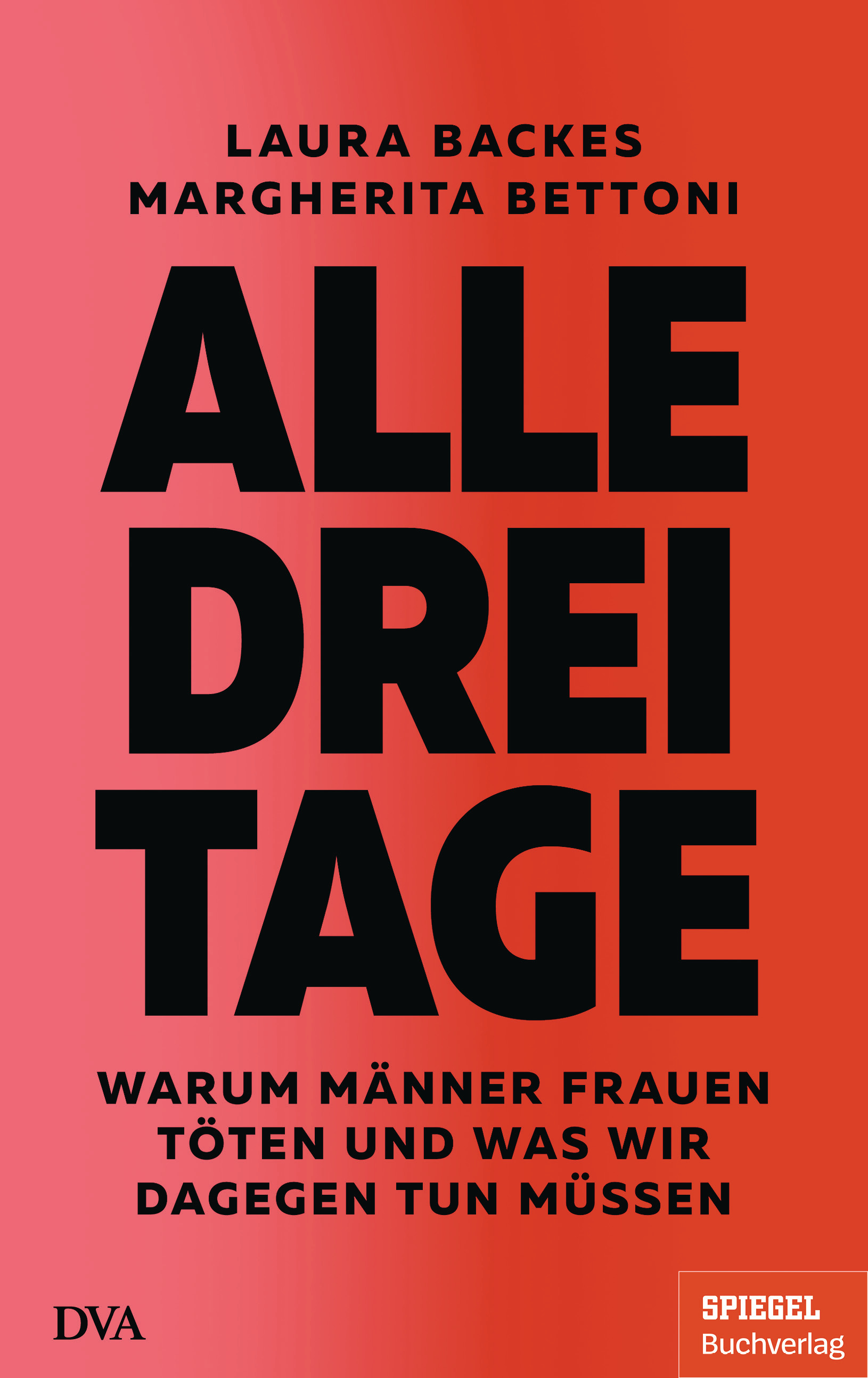
Backes, Laura / Bettoni, Marherita:
Alle drei Tage.
Warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen.
2021, 204 S., DVA
– Deutsche Verlags-Anstalt (Spiegel Buchverlag), 3-421-04874-6 / 978-3-421-04874-5, EURO 20,00
Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann, seine Frau umzubringen. Alle drei Tage wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Hinzu kommen die Morde an Frauen
durch ihnen unbekannte Täter. Diese Verbrechen sind keine Ehrenmorde oder Beziehungstaten, sondern Femizide: Morde, die an Frauen verübt werden, weil sie Frauen sind. Laura Backes und Margherita Bettoni zeigen in
ihrem aufrüttelnden Buch, dass die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts auch bei uns ein ernsthaftes gesamt-gesellschaftliches Problem ist. Als Familientragödien, Beziehungstaten oder Eifersuchtsdramen
verharmlost, bleiben viele Frauenmorde verborgen und verdecken die patriarchalen Macht- und Gewaltmuster, die sich tief durch unsere Gesellchaft ziehen. Die beiden Journalistinnen haben mit Überlebenden gesprochen, Experten
befragt, die Motive männlicher Gewalttäter untersucht und ihre Taten rekonstruiert. Eindrücklich zeigen sie, dass Femizide uns alle angehen – und warum wir jetzt handeln müssen.
Inhalt:
Vorwort / Protokoll 1: „Seit meiner Aussage schlafe ich endlich wieder besser.“ / Kapitel 1: Femizide – Die meisten Taten folgen einem Muster / Kapitel 2: Welche
Männer zu Tätern werden – Biografische Erfahrung und Besitzansprüche / Protokoll 2: „Ich habe Angst vor dem Tag, an dem er aus dem Gefängnis kommen wird.“ / Kapitel 3: Die Angehörigen
– Wenn der Vater zum Täter und die Schwester zum Opfer wird / Protokoll 3: „Aus heutiger Sicht hätte ich mir früher Hilfe holen sollen.“ / Kapitel 4: Zeit für eine neue Rechtsprechung
/ Protokoll 4: „Ich habe angefangen, mich selber zu lieben.“ / Kapitel 5: „Beziehungsdrama“ – Die Berichterstattung über Femizide ist oft verharmlosend / Protokoll 5: „Der Staat schützt
uns Frauen nicht.“ / Kapitel 6: Femizide – ein weltweites Problem – Was wir von anderen Ländern lernen können / Kapitel 7: Ein weiter Weg – Was in Deutschland getan wird und was noch zu tun
ist / Dank / Literaturverzeichnis.
Laura Backes, geboren 1987 im Saarland, hat Politik und Philosophie in Deutschland und Frankreich studiert. Die
Autorin lebt in Hamburg und arbeitet seit 2016 beim „Spiegel“, zuerst im Ressort Deutschland, inzwischen als stellvertretende Ressortleiterin in der Kultur. Sie hat regelmäßig über sexuelle Gewalt
und Gewalt gegen Frauen berichtet.
Margherita Bettoni, geboren 1987 in Italien, ist Investigativjournalistin mit den Schwerpunkten Organisierte
Kriminalität und sexualisierte Gewalt. Sie ist Co-Autorin der Bücher „Die Mafia in Deutschland. Kronzeugin Maria G. packt aus“ (Econ, 2017) und „Corona: Geschichte eines angekündigten Sterbens“
(dtv, 2020). Für ihre Recherchen hat sie den Marlies-Hesse-Nachwuchspreis, den Migration Media Award und den Grimme Online Award gewonnen.
(vt) KTS 71
|
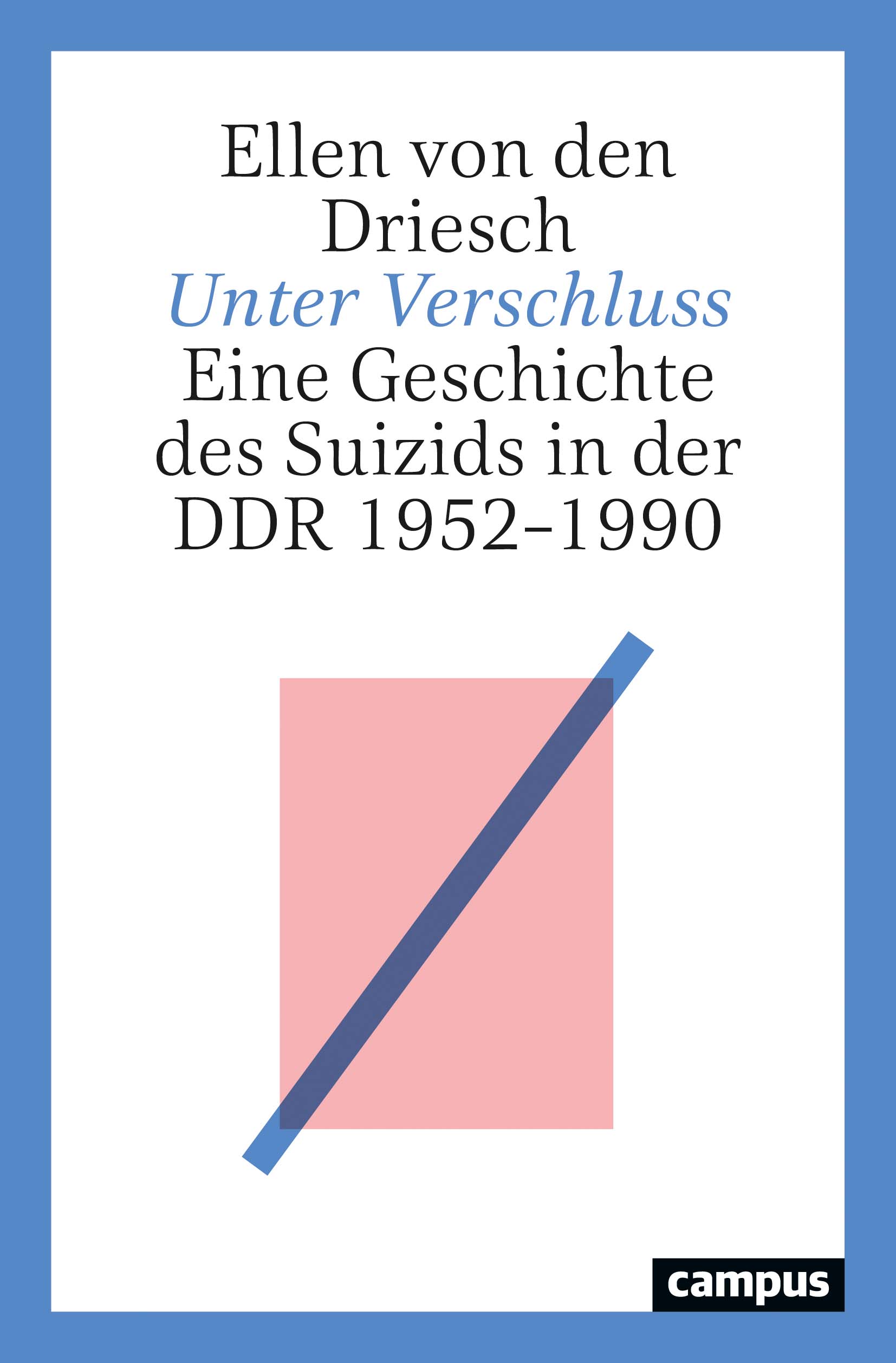
Driesch, Ellen von den:
Unter Verschluss.
Eine Geschichte des Suizids in der DDR 1952-1990.
2021, 326 S., Campus Verlag, 3-593-51329-3 / 978-3-593-51329-4,
EURO 36,00
Kaum eine Todesursache gibt so viel Aufschluss über das Wohl einer Gesellschaft wie der Suizid. In der DDR wurden vergleichbare und valide Suizidzahlen systematisch erhoben,
aber strengstens geheim gehalten. Die seit Mitte der 1970er-Jahre als „Vertrauliche Verschlusssache“ eingestuften Stastistiken war nur einer sehr kleinen Gruppe zugänglich. Ellen von den Driesch hat diese
verloren geglaubten Daten wiederentdeckt und in umfangreichen Recherchen eine völlig neue Datenbasis geschaffen. Erstmals erlaubt dieses bisher unveröffentlichte Material eine systematische Analyse der Veränderungen
der Suiziddaten in der Deutschen Demokratischen Republik. Das Buch, das das Suizidgeschehen in der DDR in historische und sozialwissenschaftliche Bezüge einbettet, verfolgt dabei mehrere Ziele: Es sensibilisiert für
die Thematik der soziologischen Suizidforschung und schafft einen Informationsgewinn hinsichtlich der Suizidmortalität in der DDR über Raum und Zeit hinweg.
Ellen von den Driesch, Dr. phil., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Sie
beschäftigt sich als Demographin mit Fragen der Sozialstruktur und sozialen Ungleichheit.
https://www.bib.bund.de/DE/Institut/Mitarbeiter/von-den-Driesch/von-den-Driesch.html?cms_layoutType=lebenslauf
(vt) KTS 71
|
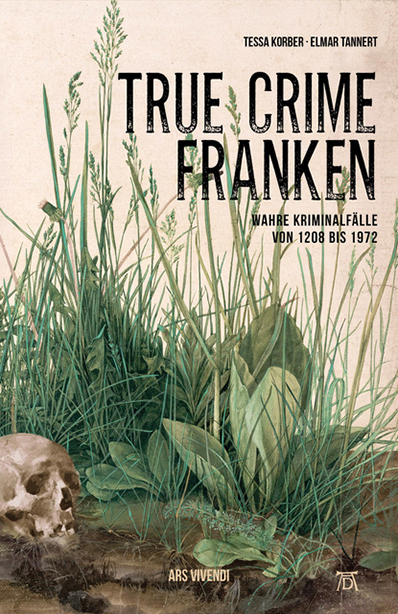
Korber, Tessa / Tannert, Elmar:
True Crime Franken.
Wahre Kriminalfälle von 1208 bis 1972.
2021, 224 S., 1 Übersichtskarte Franken mit
Tatorten (im Anhang: Nachwort / Quellenverzeichnis), ars vivendi verlag, 3-7472-0227-6 / 978-3-7472-0227-2, EURO 16,00
In fiktionaler Form berichten und erzählen Tessa Korber und Elmar Tannert von und über zwölf Kriminalfälle, die sich in der Zeit von 1208 bis 1972 in neun Gemeinden
und Städten in Franken zugetragen haben, und landesweite Beachtung fanden. Der Leser begegnet Henkern, Königsmördern, Auftragsmödern und Hochstaplern. Die Fiktionalisierung dieser meist mörderischen
Begebenheiten und Ereignisse folgen keiner zeitlichen Chronologie. Im Nachwort wird dann noch einmal auf diese wahren Kriminalfälle und deren Hintergründe in kurzer Berichtsform eingegangen. Beschlossen wird „True
Crime Franken“ mit einem Quellenverzeichnis und einer Übersichtskarte der Tatorte und Tatjahre (Volkach, Schweinfurt, Bamberg, Kulmbach, Kugelau, Gaiganz, Nürnberg, Reichelshofen, Kleinochsenfurt).
Inhalt:
Blutspuren lügen nicht. Eine revolutionäre Ermittlungsmethode, Reichelshofen 1962 / Das erste Mal. Die Fälle des Schweinfurter Nachrichters Hans Binder 1638-1647
/ Die Hitlerlinde. Eine Kichweihschlägerei 1933 in Gaiganz wird zum politischen Mord erklärt / Der goldene Apfel. Der Alchemist Krohnemann, gehenkt wegen Betrugs in Kulmbach 1686 / Der Königsmord. Das Attentat
auf Philipp von Schwaben in Bamberg 1208 / Don Giovanni von Bamberg. Der Auftragsmord des Domkapitulars Dalberg an einem nächtlichen Ruhestörer, 1782 / Der harte Lauf. Der Mord an einer Bäuerin in Kugelau bei
Waischenfeld 1920 / … kann sich von der Lüge nicht trennen … Die Raubmörderin Christine Hilpers, Nürnberg 1849 / „König Armleder“ – Ein Dokumentarfilm-Exposé. Die von
Arnold von Uissigheim geführten Pogrome in Unterfranken 1336 / Der grüne Mantel. Ein Fall von Weindiebstahl, dargestellt im Volkacher Salbuch 1504 / Wie man eine Legende erschafft. Ein Mord im Auftrag des Nürnberger
Rates 1514 / Der Prozess. Doppelmord und Grabschändungen in Nürnberg 1972 / Nachwort / Quellenverzeichnis.
Tessa Korber, geboren 1966, ist promovierte Germanistin und lebt als freie Schriftstellerin in Nürnberg.
www.tessa-korber.de
Elmar Tannert, geboren 1964, lebt als Schriftsteller und Übersetzer in Nürnberg.
www.elmar-tannert.de
(tp) KTS 71
|
8 Fragen an Tessa Korber
Kurzbio: geb. 1966 in Grünstadt/Pfalz, aufgewachsen in Forchheim/Ofr. Studium der Germanistik und Geschichte mit Promotion
in Erlangen. Seit 1998 freie Schriftstellerin.
Homepage: www.tessa-korber.de
Thomas Przybilka: Was bedeutet Kriminalliteratur für Sie und ist, Ihrer Meinung nach, Kriminalliteratur eine wichtige Literaturgattung?
Tessa Korber: Meiner Ansicht nach ist der Krimi das heute wichtigste Subgenre des Gesellschaftsromans.
Gleichzeitig ist das Genre vielgestaltig und hat unterschiedliche Wurzeln, entsprechend verschiedene Ausprägungen: Ein Krimi kann nach der Rolle des Bösen im Menschen und in der Gesellschaft fragen. Er kann auch
einfach nur ein intellektuelles Spiel sein. Er ist von der Grundanlage her – leserfreundlich - auf das konservative Erzählen einer Handlung angelegt, gleichzeitig aber offen und geeignet für sprachliche und
formale Experimente.
Für mich als Autorin ist er reizvoll, weil er einerseits handwerklich ist und zu Überlegungen im Bereich Form anregt.
Andererseits mag ich ihn, weil er proteisch ist und alles sein kann: politisch, historisch, psychologisch, absurd, satirisch, unterhaltsam, analytisch … die Liste ist endlos. In die Krimiform lassen sich die unterschiedlichsten
Intentionen gießen.
TP: Ihr Weg zur Kriminalautorin / zum Kriminalautor?
TK: Mein Weg führte über das begeisterte Lesen. Als
Germanistikstudentin habe ich dann versucht, meiner
eigenen Leseleidenschaft auf die Spur zu kommen und habe
wissenschaftlich über das Genre gearbeitet. Was die
Leselust aber nur noch mehr befeuert hat.
TP: Ihre erste Krimi-Veröffentlichung?
TK: 1999 „Toter Winkel“. Ich wollte eine unperfekte
Ermittlerin voller Selbstzweifel, die in einer
klischeegeprägten Welt versucht, selbst kein Klischee zu
werden.
TP: Wurden Sie vom Werk einer Krimiautorin / eines
Krimiautoren beeinflusst?
TK: Ich mochte immer den französischen Krimi, der einerseits
sehr politisch sein kann, andererseits eine starke Wurzel
im Surrealismus hat. Etwa Pennacs frühe Malaussène-Krimis.
Oder die von Vautrin. Generell alle schwarzhumorigen, das
Absurde streifenden Werke. Etwa William Marshall. Aber das
heißt nicht, dass ich je versucht hätte, „so zu schreiben
wie“. Man versucht ja im Gegenteil immer, die eigene
Stimme zu finden.
TP: Gibt es den „Frauenkrimi“ (im Sinne von feministischer
Kriminalliteratur)?
TK: Das ist nicht mein Thema.
TP: Gibt es einen Kriminalroman/Thriller, den Sie selber gerne
geschrieben hätten?
TK: Nein, so denkt man doch nicht beim Lesen. Auch, wenn man
etwas großartig findet. Es regt einen aber an, selber
weiterzuarbeiten.
Lieber als etwas „geschrieben zu haben“, würde ich gern
jenes nächste Buch schreiben, das in mir schlummert. Und
dann das nächste. Und das nächste.
TP: Welche Autorin / welcher Autor ist Ihrer Meinung nach
überschätzt (national und/oder international)?
TK: Kollegenbashing ist immer unschön. Sagen wir: eine mehr
als schlichte Sprache, verbunden mit einer überzogenen
Form der Spannung, bei der Figurenpsychologie und
Wahrscheinlichkeit keine Rolle mehr spielen, langweilt
mich einfach.
TP: Welche Autorin / welcher Autor ist Ihrer Meinung nach
unterschätzt (national und/oder international)?
TK: Außer mir? :-) Ich denke, die Guten werden bereits
geschätzt. Die Schlechten verkaufen sich nur trotzdem
häufiger.
Kriminalromane / Thriller:
--- 2000, Toter Winkel
--- 2001, Tiefe Schatten
--- 2003, Falsche Engel
--- 2004, Triste Töne
--- 2005, Kalte Herzen
--- 2007, Teurer Spaß
--- 2010, Das Leben ist mörderisch. Krimierzählungen.
--- 2011, Todesfalter. Ein historischer Krimi um Maria Sibylla
Merian
--- 2012, Gemordet wird immer. Bestatter-Krimi 1
--- 2013, Die Saubermänner
--- 2014, Zum Sterben schön. Bestatter-Krimi 2
--- 2016, Die Katzen von Montmartre
--- 2017, Kaspar sucht Hauser. Kinderkrimi
--- 2018, Schweig wie ein Grab. Bestatter-Krimi 3
--- 2020, Noch einmal sterben vor dem Tod
Zusammen mit Christian Klier
--- 2016 Knochenjob
Als Tess Riley/Christian Brand
--- 2015 Jack. Thriller
--- 2016 Unternehmen JFK. Thriller
Herausgeberschaft
--- 2011, Fiese Morde aus der Provinz
--- 2013, Auf leisen Pfoten kommt der Tod
--- 2019, Weinfrankenmorde. 9 Kurzkrimis aus Franken
--- 2020, Bocksbeutelmorde. 12 Weinfrankenkrimis
*****
Zusammen mit Elmar Tannert
--- 2021, True Crime Franken. Wahre Kriminalfälle von 1208 bis
1972
© Thomas Przybilka
Bonner Krimi Archiv Sekundärliteratur – BoKAS
8 Fragen an Elmar Tannert
Kurzbio: *1964 in München, aufgewachsen in Nürnberg. Studium der Musikwissenschaft
und Romanistik. Tätig in diversen Jobs, u. a. Buchhändler, Tankwart, Paketzusteller. Seit 2003 freier Autor, Lektor und Übersetzer.
Homepage: www.elmar-tannert.de
Thomas Przybilka: Was bedeutet Kriminalliteratur für Sie und ist, Ihrer Meinung nach, Kriminalliteratur eine wichtige Literaturgattung?
Elmar Tannert: Gute Kriminalliteratur kann den Blick in Täterpersönlichkeiten öffnen
und begreiflich machen, was einen Menschen zu seinen Taten treibt.
TP: Ihr Weg zur Kriminalautorin / zum Kriminalautor?
ET: Es fällt mir nicht leicht, dieses Geständnis abzulegen,
aber es war der Wunsch meines Verlegers, daß ich mich in
diesem Genre versuchen möge.
TP: Ihre erste Krimi-Veröffentlichung?
ET: „Rache, Engel!“, verfaßt mit Petra Nacke, erschienen 2008.
TP: Wurden Sie vom Werk einer Krimiautorin / eines
Krimiautoren beeinflusst?
ET: Das ist ganz schwer zu sagen. Einerseits kann man all das,
was man gelesen hat, nicht ausschalten; andererseits
versucht man ja genau das, wenn man selber schreibt. Aber
angenommen, ich würde mich ganz bewußt beeinflussen lassen
wollen, so würde ich mich eher an einen Autor außerhalb
des Krimigenres halten.
TP: Gibt es den „Frauenkrimi“ (im Sinne von feministischer
Kriminalliteratur)?
ET: Das weiß ich nicht, denke mir aber, daß Literatur
grundsätzlich nicht „-istisch“ sein sollte.
TP: Gibt es einen Kriminalroman/Thriller, den Sie selber gerne
geschrieben hätten?
ET: „Hätte ich selber gern geschrieben“ denke ich mir zuweilen
von guten Sätzen, vielleicht noch von einzelnen Szenen,
aber niemals von ganzen Büchern.
TP: Welche Autorin / welcher Autor ist Ihrer Meinung nach
überschätzt (national und/oder international)?
ET: Generell scheinen mir manche Autoren des sogenannten
Regionalkrimis ein wenig überschätzt zu sein, aber ich
glaube, damit sage ich nichts Neues.
TP: Welche Autorin / welcher Autor ist Ihrer Meinung nach
unterschätzt (national und/oder international)?
ET: Die Versuchung ist groß, „ich natürlich“ hinzuschreiben.
Aber Spaß beiseite – die wahren Perlen sind womöglich so
sehr unterschätzt, daß sie außerhalb des allgemeinen wie
auch meines eigenen Aufmerksamkeitsradius‘ liegen, wer
weiß?
Kriminalromane / Thriller:
Zusammen mit Petra Nacke
--- 2008, Rache, Engel!
--- 2010, Blaulicht
--- 2012, Der Mittagsmörder
*****
Zusammen mit Tessa Korber
--- 2021, True Crime Franken. Wahre Kriminalfälle von 1208 bis
1972
© Thomas Przybilka
Bonner Krimi Archiv Sekundärliteratur – BoKAS
*****
|
|
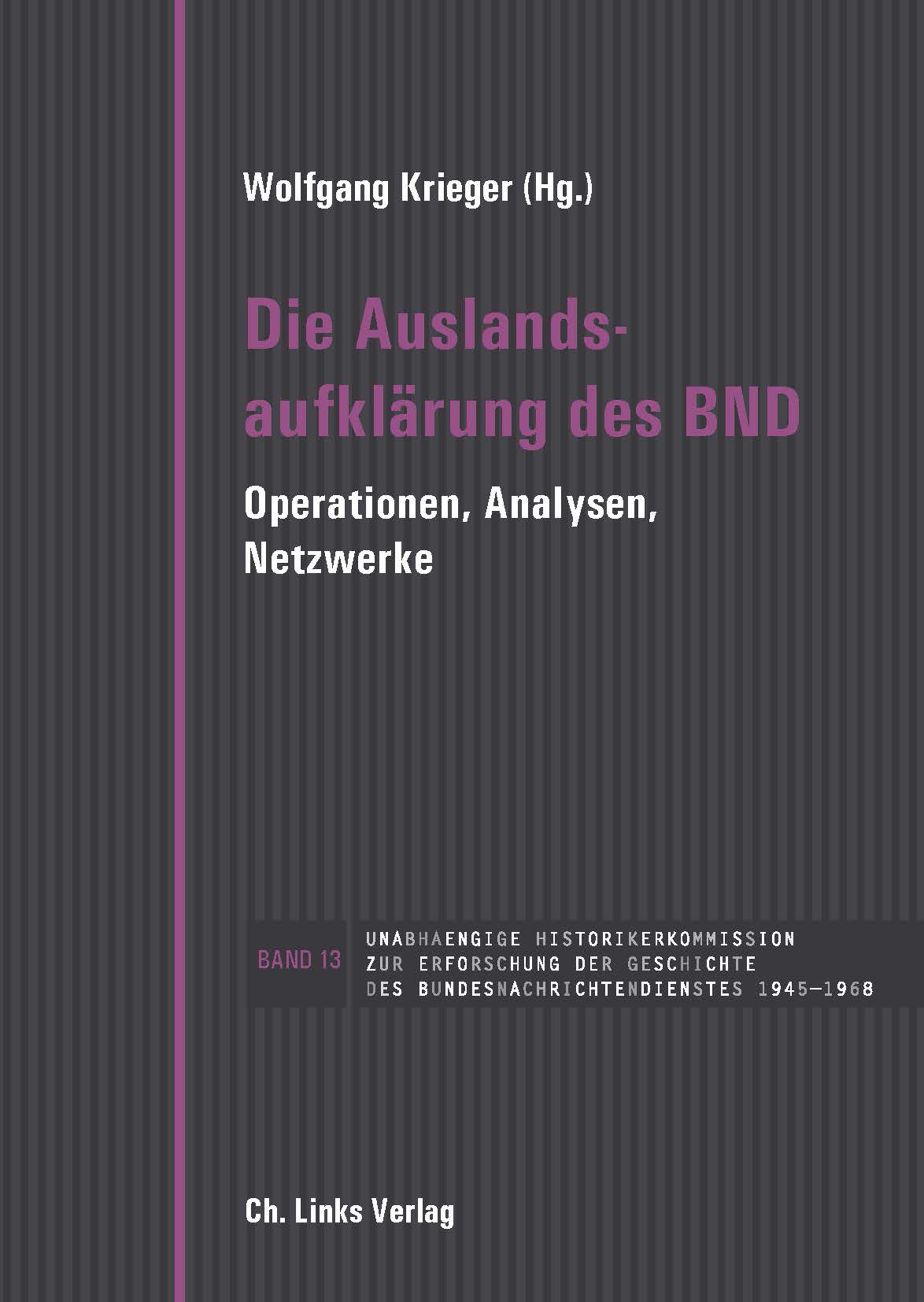
Krieger, Wolfgang (Hg) [in Verbindung mit Andreas Hilger und Holger M. Meding]:
Die Auslandsaufklärung des BND.
Operationen, Analysen, Netzwerke.
2021, 968 S., Ch. Links Verlag (UHK –
Unabhängige Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes 1945-1968, Bd. 13), 3-96289-118-8 / 978-3-96289-118-3, EURO 80,00
Die globale Auslandsaufklärung ist das Kerngeschäft des BND. Dabei geht es zum einen darum, frühzeitig Aufschluss über die geheimen Absichten und Fähigkeiten
möglicher Gegner zu erlangen, zum anderen darum, verdeckte Operationen auszuführen, um Einfluss zu nehmen. In der Zeit bis 1968 standen diese Tätigkeiten ganz im Zeichen der Systemkonkurrenz zwischen Ost und
West. Gestützt auf bislang unzugängliche Quellen aus dem BND-Archiv untersucht dieser Band, wie gut der Nachrichtendienst in jener Zeit für seine Aufgaben gerüstet war, was konkret von ihm verlangt wurde
und wie erfolgreich er bei der Umsetzung war. Aufschluss geben Fallbeispiele zur Sowjetunion, Südosteuropa, Lateinamerika, dem Nahen und Mittleren Osten sowie Nordafrika.
Prof. Dr. Wolfgang Krieger, Jahrgang 1947, ist Universitätsprofessor für Neuere Geschichte. Er war Fellow in Oxford und Harvard, lehrte
in München und Marburg sowie als Gastprofessor in Bologna, Princeton, Toronto und Paris. Zahlreiche Publikationen zur Geschichte der internationalen Beziehungen sowie zur Geschichte von geheimen Nachrichtendiensten.
www.wolfgangkrieger.com
/vt) KTS 71
|
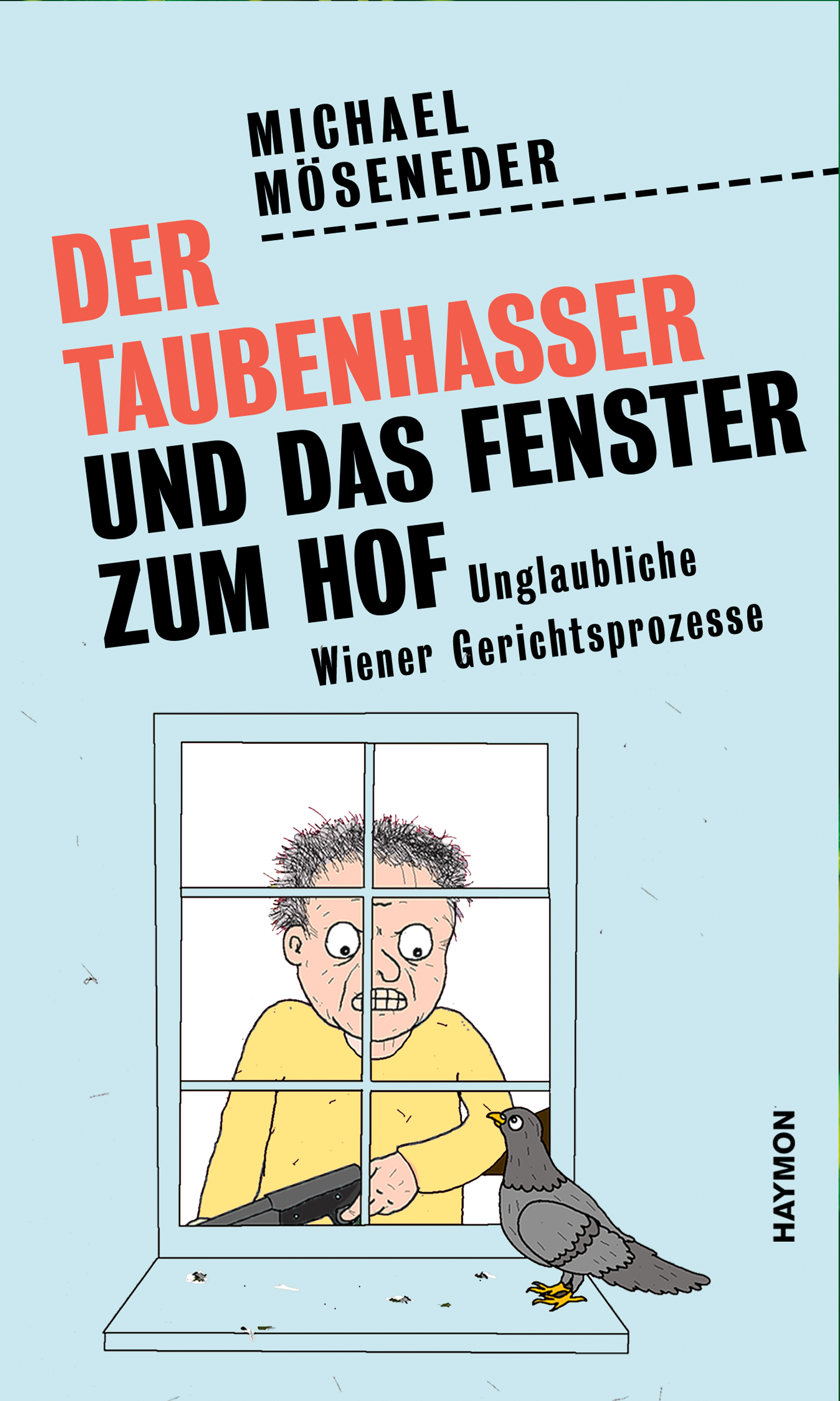
Möseneder, Michael:
Der Taubenhasser und das Fenster zum Hof.
Unglaubliche Wiener Gerichtsprozesse.
2021, 222 S., 6 s/w Fotos, Haymon Verlag,
3-7099-8104-2 / 978-3-7099-8104-7, EURO 19,90
Michael Möseneder schildert in 52 Kapiteln, gegliedert in sechs Abteilungen, zum Teil absurde, kuriose wie auch tragische Kriminalfälle, die vor Wiener Gerichten in Prozessen
verhandelt wurden. In „Der Taubenhasser“ hat er die außergewöhnlichsten Prozesse seiner Laufbahn als Gerichtsreporter für die Wiener und überregionale österreichische Tageszeitung „Der
Standard“ versammelt. Gleich ob zum Fremdschämen, Mitfühlen oder Erschrecken – Möseneders Gespür für spannende Verhandlungen hat ihn nie getrogen. Eine untalentierte Betrüger-Oma,
ein Kerl, der eine Straßenbahn klaute oder auch Verbrechen, die schockieren – Michael Möseneder porträtiert diese verschiedenen Gerichtsverfahren und die involvierten Personen stets auf unterhaltsame
Art und Weise. Es sind die „kleinen“ Prozesse, die die Sozialisation der Kläger und Beklagten nachzeichnen. Bewußt und gekonnt verzichtet Möseneder darauf, seine Leserschaft „mit einem Sozialporno
zu bespaßen“. Den publikumsheischenden und aufsehenerregenden Großverfahren widmet er daher nur ein einziges Kapitel. Einige der hier geschilderten Kriminalprozesse wurden bereits im „Standart“
veröffentlicht, andere werden zum ersten Mal in „Der Taubenhasser“ publiziert. Jede Abteilung wird mit einem kleinen Exkurs „Aus dem Leben des Blutchronikers“ abgeschlossen – „Blutchronik“
steht medienintern für die Kriminal- und Justizberichterstattung.
Inhalt:
--- Das Leben zwischen Buchstaben und Paragraphen.
--- 1: Wenn man seinen Ohren kaum traut (Topfpflanzenstreit beim Bundesheer / Der Shoppingsender und die betrügerische Pensionistin / Der Rosenbusch und der Hausbesuch mit
Schlagring / Der von einer Unbekannten angestiftete Kinderschänder / Krippenfiguren und Teddybären / Der fliegende Burger und der Schädelbasisbruch / Der Steirer und die „grüne Muschi“ / Der
Pizzabäcker und seine Peniskrümmung / Der Cam-Sex der falschen 14-Jährigen / Die wütende Mutter als Brandstifterin / Nachbarschaftsstreit im hellhörigen Altbau / Aus dem Leben eines Blutchronikers,
Teil 1).
--- 2. Die Richter und das liebe Vieh (Das tote Meerschweinchen in der Problembeziehung / Ein berühmter Gallier und Nothilfe für einen Hund / Vendetta rumd ums Wuff-Forum
/ Der Künstler und die fliegende Hund / Der Dackel mit dem Löwenherz / Der Taubenhasser und das Fenster zum Hof / Der Rottweiler, der ein Kleinkind totbiss / Aus dem Leben des Blutchronikers, Teil 2).
--- 3. Vom Beisl vor den Kadi (Wildpinkler bei den Stürmischen Tagen / Die „Indianerin“ und Schläge auf dem Damen-WC / Der ziemlich missglückte Valentinstag
/ „Mädi“ und der Würstelstand / Rabiater Diskurs im Schlingerl / Eskalierter Streit um ein Finanzamt / Drohungen gegen „Drecksschlampe“ und „Hurensohnschwiegermutter“ / Der eskalierte
Ticketkauf im Westbahnhof / Prozess um transdanubisches Beziehungsgeflecht / Der Mann, der eine Straßenbahn stahl / Aus dem Leben des Blutchronikers, Teil 3).
--- 4. Ein Fall für die Öffentlichkeit (Estibaliz C.: Die toten Männer der Eissalonbesitzerin / Korruption in höchsten Kreisen / Der Dreifachmord im niederösterreichischen
Schloss / Julia Kührer: Die verbrannten Gebeine im Weinviertler Erdkeller / Die drei vergewaltigten Teenager vom Praterstern / Der Showdown der „Star-Anwälte“ / Peter Seisenbacher: Der tiefe Fall des
Doppelolympioniken / Aus dem Leben des Blutchronikers, Teil 4).
--- 5. Folgenschwerer Verkehr (Die Parklücke und das Steirereck / Der Spitzenkoch und die Straßenverkehrsordnung / Der „Rotzbua“ und die „schwule Sau“
in der Tempo-30-Zone / Blaues Blut und Vorrangregeln / Der Zigarettenstummel und der Kettenhandschuh / Der frierende Polizist und der Schnaps des toten Schwiegervaters / Road Rage unter Radfahrern / Aus dem Leben des Blutchronikers,
Teil 5).
--- 6. Jung und teils erstaunlich dumm (Die Respektschellen als Internethit / Die Teenager und der Speisekartentrick / Die Drepressive und die Beauty-Convention / „Branding“,
„Schaumparty“ und ein trostloses Leben / Zwerg und Riese in rächender Mission / Der hilflose Lehrer und sein rabiater Sohn / Lieber vorbestraft, als im Kindergarten zu helfen / Freispruch dank mütterlichen
Misstrauens / Der Lehrling und die Nötigung mit zwei Dildos / Falsche Freunde, psychische Probleme und Weihnachtsdeko / Einladung an den Arbeitsplatz des Blutchronikers).
Michael Möseneder hat 1993 als Volontär die ersten Zeilen für den „Standard“ geschrieben und ist dann im Chronik-Ressort hängen geblieben, wo er
heute primär als Gerichtsreporter tätig ist.
(tp) KTS 71
|
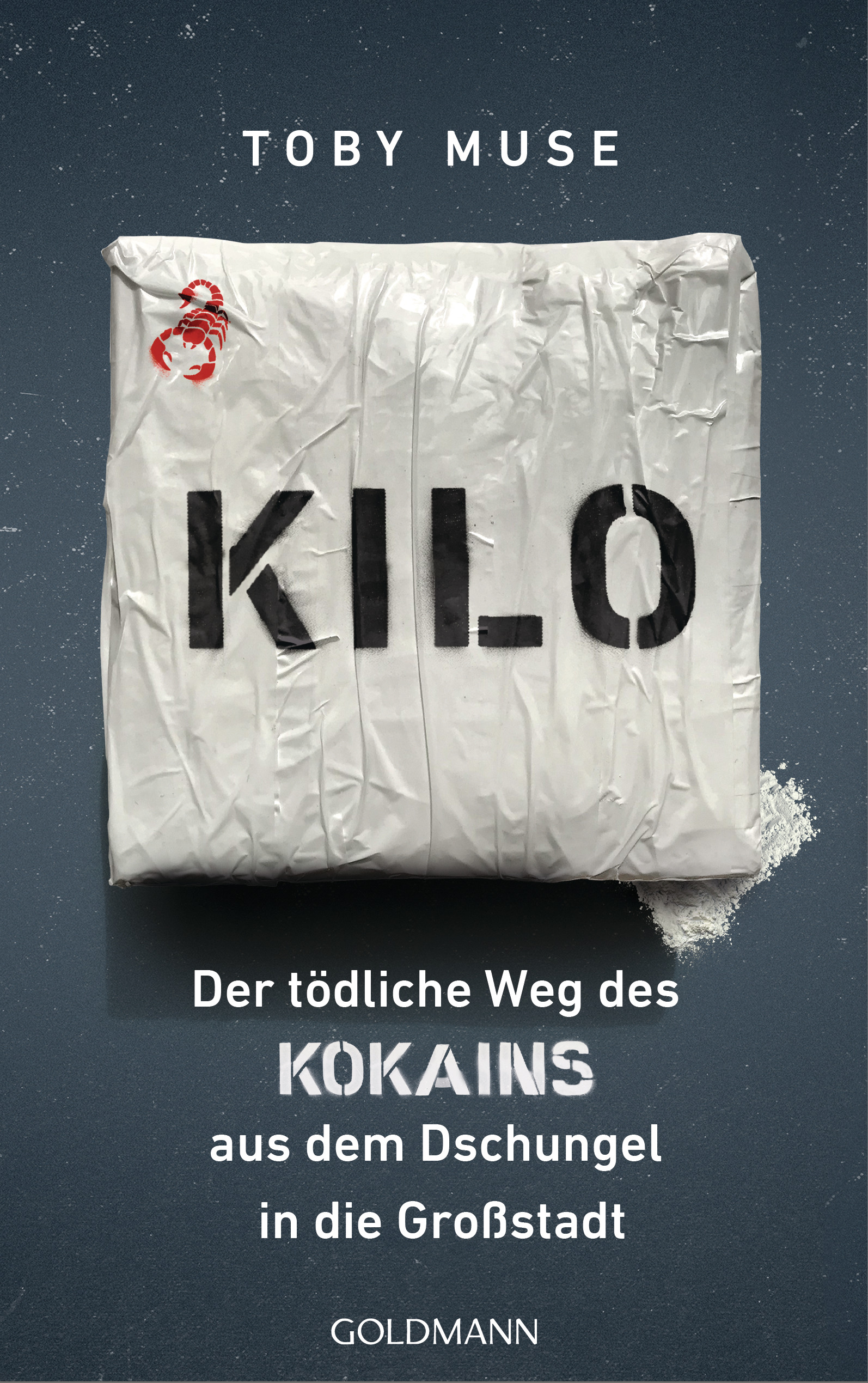
Muse, Toby:
Kilo.
Der tödliche Weg des Kokains aus dem Dschungel in die Großstadt.
2021, 448 S., 30 s/w und farbige Fotos, (Kilo. Inside
the Deadliest Cocaine Cartells – from the Jungle to the Streets, Ü. a.d. Amerikanischen v. Katrin Harlaß, Enrico Heinemann & Jörn Pinnow), Goldmann Verlag, 3-442-31582-4 / 978-3-442-31582-6, EURO
18,00
Kokain ist nach Marihuana die beliebteste Droge der Welt. Es steckt voller verführerischer Verheißungen. Verspricht Glamour, Sex, Entfesselung – und bringt doch
Gewalt und Tod mit sich. Koks ist eine Ware, die gut funktionierende Vertriebswege braucht und als Quelle unermesslichen Reichtums um jeden Preis beschützt werden muss. Die Pflückerin, der Koch im Labor, die Auftragskiller
der Kartelle, die Schmugglerin, die Drogenbarone und ihre Liebhaberinnen: Sie alle sind Teil eines gewaltigen und erbarmungslosen Systems. Toby Muse war viele Jahre in dieser Unterwelt unterwegs und erhielt seltene Einblicke
in ihre Mechanismen. In seinem Buch vollzieht er den Weg eines Kilos Koks von seinem Anbau im kolumbianischen Dschungel bis in die Nachtclubs der Reichen und Schönen nach und enthüllt dabei eindringlich die Schicksale
der Menschen, die an dieser tödlichen Reise beteiligt sind. „Kilo“ ist das hochbrisante und fesselnde Porträt eines Landes und seiner Bewohner im Würgegriff des Kokains – eine unvergessliche
Geschichte, die uns direkt ins dunkle Herz der „weißen Göttin“ führt. --- Trotz Coronapandemie und Lockdown landeten im 2021 über 16.000 Kilogramm Kokain in Deutschland, so eine aktuelle Statistik
des Bundeskriminalamts. Ein Rekordwert im Vergleich zu den Vorjahren. „Kilo ist eines der besten Bücher über den kolumbianischen Drogenhandel. Vergessen Sie alles, was sie je im Fernsehen gesehen haben: Das
hier ist der wahre Stoff“, resümiert Max Daly, Global Drugs Editor bei VICE.
Inhalt:
Vorbemerkung / Prolog: September 2016 / Das Land der Blitze / La Gabarra, La Gomorra / Sisyphus auf den Kokafeldern / Koka raubt den Städten die Seele / Eine Geschichte des
Kokains in fünf Narcos / Die Combos / Unsere Heilige Jungfrau der Meuchelmörder / Der Capo / Die Jagd nach dem Biest / Einen Schatten töten / Ein Friedhof für Träume / Tummelplatz der Haie / Epilog:
Das Ende (Es endet niemals) / Danksagungen / Bildnachweis / Copyright.
Toby Muse ist ein britisch-amerikanischer Journalist, Kriegsreporter und Dokumentarfilmer, der aus Kolumbien, Irak und Syrien berichtet hat. Er war 15 Jahre lang in den zentralen
Schaltstellen der kolumbianischen Drogenkartelle unterwegs und hat für sein erstes Buch „Kilo“ mit Pflückerinnen, Kurieren, U-Boot-Piloten, Auftragskillern und Drogenbaronen gesprochen.
www.tobymuse.com
(vt) KTS 71
|
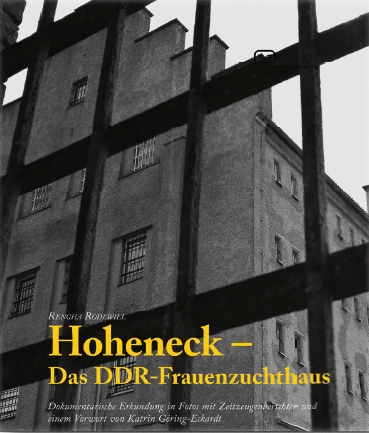
Rodewill, Rengha:
Hoheneck – Das DDR-Frauenzuchthaus.
Dokumentarische Erkundung in Fotos mit Zeitzeugenberichten.
2014, 200 S., über
200 s/w Fotos, (Vorwort: Katrin Göring-Eckardt), Vergangenheits Verlag, 3-86408-162-9 / 978-3-86408-162-0, EURO 24,99
Hoheneck – Das DDR-Frauenzuchthaus. Der Ort ist bis heute Synonym für die Verfolgung politisch unliebsamer Frauen in der DDR. Es ist ein Ort des Schreckens. Hier wurde
gefoltert, gab es Isolations- und Dunkelhaftzellen, war die DDR unterdrückend wie sonst kaum. Kein Wort vermag eine so tiefe Betroffenheit auszulösen wie der Anblick eines authentischen Ortes. Die Berliner Fotografin
Rengha Rodewll folgt seit Jahren den Spuren politischer Häftlinge in der ehemaligen DDR, die wie auch in Hoheneck nach ihren Verhaftungen zu Nummern gemacht wurden. Rengha Rodewill möchte als Künstlerin und
Fotografin mit dieser Fotodokumentation und den Erlebnisberichten ehemaliger inhaftierter Frauen aus dem Gefängnis in Hoheneck zur Erinnerungskultur über diesen berüchtigten Ort beitragen, der wie kein anderer
für die Willkür und das Misstrauen der DDR stand. Herausgekommen sind über 200 eindringliche Fotografien, die spürbar nah diesen Ort erkunden, der für Tausende Frauen in der DDR den Ausschluss vom
Leben bedeutete.
Rengha Rodewill, geboren in Hagen/Westfalen, lebt in Berlin, arbeitet als Malerin und Fotografin.
www.rengha-rodewill.com
(vt) KTS 71
|
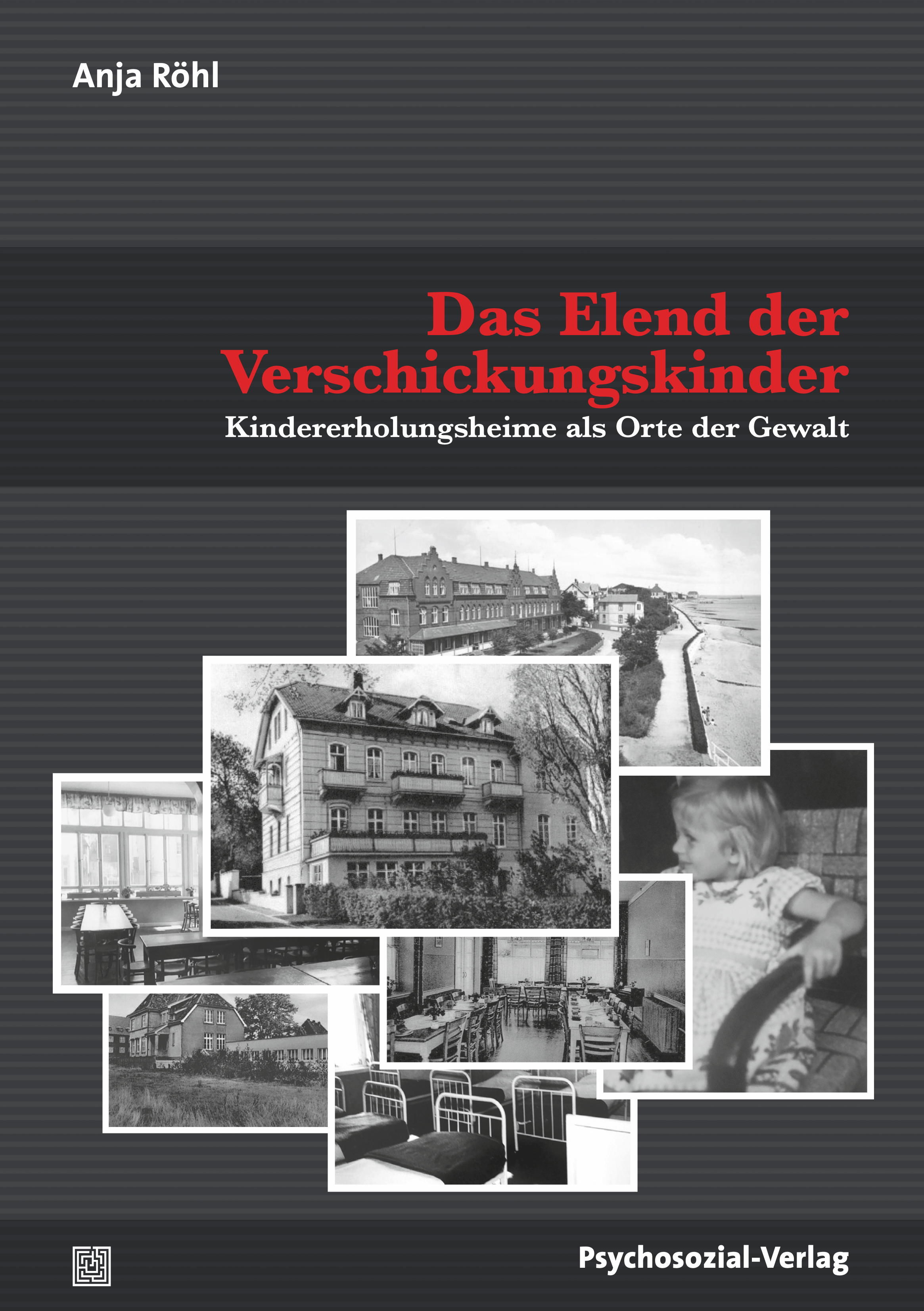
Röhl, Anja:
Das Elend der Verschickungskinder.
Kindererholungsheime als Orte der Gewalt.
2021, 306 S., Psychosozial Verlag (Sachbuch Psychosozial),
3-8379-3053-X / 978-3-8379-3053-5, EURO 29,90
Zwischen den 1950er und 1990er Jahren wurden in Westdeutschland zwischen acht und zwölf Millionen Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren auf kinderärztliches Anraten
und auf Kosten der Krankenkassen ohne Eltern zur „Erholung“ verschickt. Während der meist sechswöchigen Aufenthalte an der See, im Mittelgebirgsraum oder im Hochgebirge sollten die Kinder „aufgepäppelt“
werden. Tatsächlich erlebten sie dort jedoch oft Unfassbares. Die institutionelle Gewalt, die sich hinter verschlossenen Türen ereignete, reichte von Demütigungen über pysische Gewalt bis hin zu sexuellem
Missbrauch. Betroffene leiden noch heute an den Folgen der erlittenen Traumata. Anja Röhl gibt den Verschickungskindern eine Stimme und möchte die Träger ehemaliger Verschickungsheime in die Verantwortung nehmen.
Sie zeigt, welches System hinter den Kinderkuren stand und geht möglichen Ursachen für die dort herrschende Gewalt nach. Das Buch ist ein erster großer Schritt zur Aufarbeitung eines bisher unerforschten Bereichs
westdeutscher Nachkriegsgeschichte und zur Anerkennung des Leids Betroffener.
Inhalt:
--- Das Verdrängte kehrt zurück – Vorbemerkung.
--- Verschickungskinder finden sich (Erste Schritte zur Aufarbeitung / Erste Indizien / Aufarbeitung und Anerkennung des Leids).
--- Ein Blick in die Literatur. Kinderverschickung – bisher kein Forschungsgegenstand (Medizinische Pädagogik in pädiatrischer Fachliteratur der 1950er und 1960er
Jahre / Hände hoch! Medienresonanz).
--- „Verschickung“ – Versuch einer kritischen Annährung. Begriff, Definition und historischer Hintergrund (Erste Zahlen für die 1960er Jahre / Diagnostik
im Sinne des Geschäftsmodells / Bedingungen des Aufenthalts).
--- Kindererholungsheime (Die Kinderheilstätte Seehospiz auf Norderney / Heime und Berichte der Nordseeinsel Föhr / Heime und Berichte der Insel Borkum / Bad Salzdetfurth
als Kinderheim-Heilbad / Der Kurort Bad Rothenfelde und seine Heime / Der Heimkurtort Bad Sachsa / Berchtesgaden / Scheidegg).
--- Erste empirische Zahlen (Bestrafungen für unwillkürliche Vorgänge / Zu Demografie und Trägeranalyse).
--- Ursachensuche (Erster Ursachenstrang: Biografische Prägung während des Nationalsozialismus / Zweiter Ursachenstrang: Prägung durch NS-Schwesternschaft und Pflegeberufe
/ Dritter Ursachenstrang: Strafende Pädagogik / Vierter Ursachenstrang: „Totale Institution“ / Fünfter Ursachenstrang: NS-Geschichte der Kinderheilkunde / Sechster Ursachenstrang: Balneologie sowie Klimaheilkunde
und –therapie / Siebter Ursachenstrang: Medizinische Forschungen / Achter Ursachenstrang: Ökonomie und Rendite / Neunter Ursachenstrang: Sadismus).
--- Für eine empathische Pädagogik – Schlussbemerkung.
--- Literatur, Danksagung.
Anja Röhl machte das Trauma der Verschickungskinder 2019 in der breiten Öffentlichkeit publik. Als Betroffene gründete die Sonderpädagogin und Autorin 2019 mit
anderen ehemaligen Verschickungskindern die Initiative Verschickungskinder. Sie hält Vorträge zum Thema und sammelt seit Jahren Betroffenenberichte. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen
Frühpädagogik, institutionelle Gewalt und transgenerationale Weitergabe von NS-Erziehung. Zuletzt erschien von ihr 2013 das Buch „Die Frau meines Vaters. Erinnerungen an Ulrike“.
www.anjaroehl.de
www.verschickungsheime.de
(vt) KTS 71
In (nicht mittelbarem) Zusammenhang mit der o.g. Untersuchung dürfte aber auch das „Gercke-Gutachten“ von Interesse sein:
Seit Monaten wird in der Presse über den (sexuellen)
Missbrauch von Kindern durch Kleriker berichtet. Am
Donnerstag, 18. März 2021, wurde das sogenannte „Gercke-
Gutachten“ über den Umgang mit sexuellem Missbrauch im
Erzbistum Köln dem dortigen Kardinal Rainer Maria Woelki
von RA Björn Gercke übergeben. Um sich eine Meinung zu
bilden, ist dieses Gutachten nachzulesen unter:
https://mam.erzbistum-koeln.de/web/4e65e316aeec6ed4/gutachten--pflichtverletzungen-von-di-zesanverantwortlichen-im-erzbistum-k-ln-im-umgang-mit-f-llen-sexuellen-missbrauchs-zwischen-1975-und-2018/?mediaId=6CC89941-D1E9-42B7-A537E652C91E5E6A
(tp) KTS 71
|
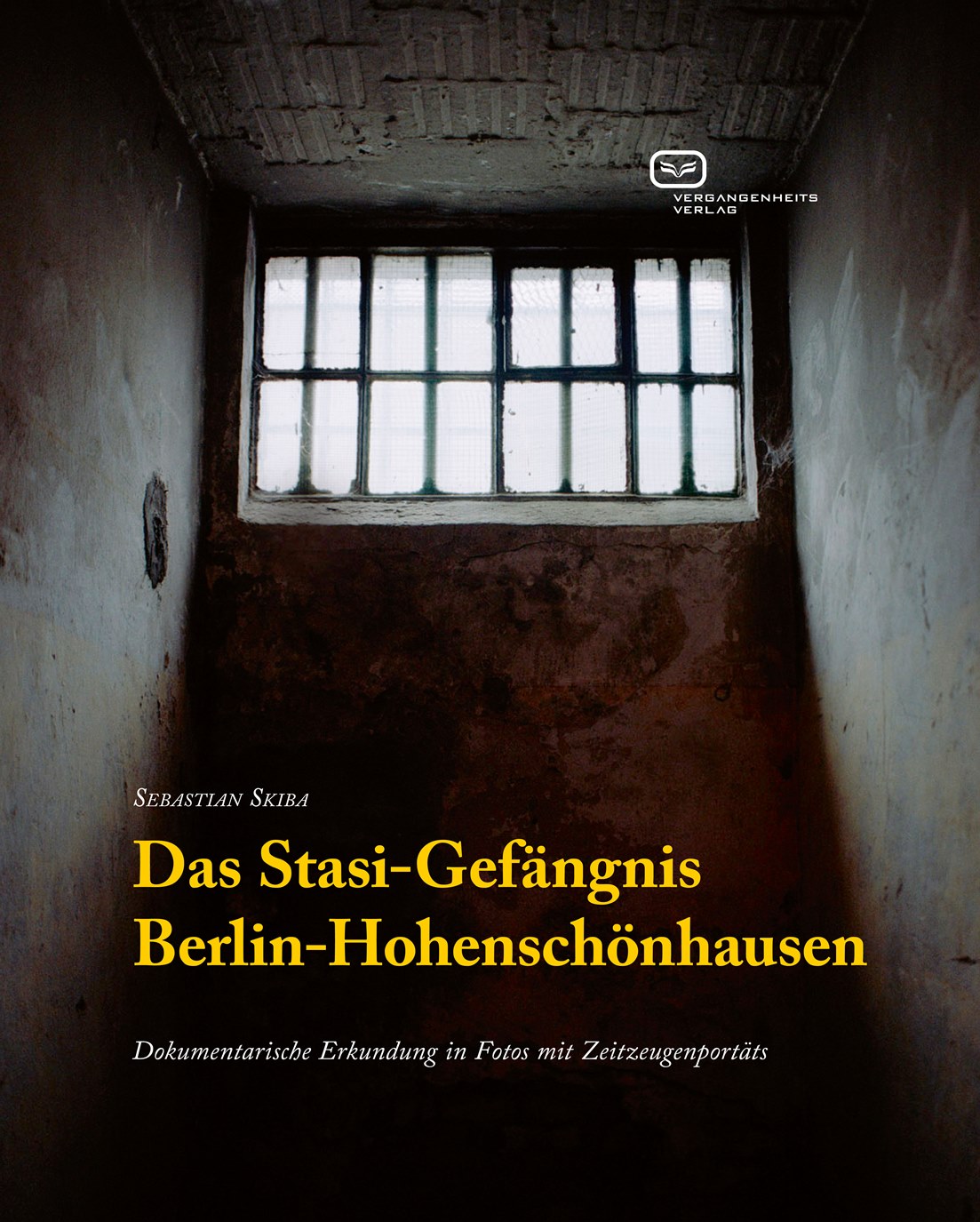
Skiba-Gutjahr, Sebastian:
Das Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen.
Dokumentarische Erkundungen in Fotos mit Zeitzeugenporträts.
2019, 200 S., zahlreiche farbige Abbildungen, Vergangenheits Verlag, 3-86408-185-8 / 978-3-86408-185-9, EURO 24,99
Es gibt nur wenige Erinnerungsorte in Deutschland, die so eindringlich die mehr als 40-jährige Geschichte politischer Verfolgung und Unterdrückung in der Sowjetischen
Besatzungszone und der DDR wie die Untersuchungshaftanstalt in Berlin-Hohenschönhausen widerspiegelt. Sie steht stellvertretend für die Willkür des sowjetischen Geheimdienstes nach dem Ende des 2. Weltkrieges
und den Totalitarismus des DDR-Regimes. Von außen sah alles unscheinbar aus. Auf Ost-Berliner Stadtplänen existierte das Gefängnis nicht einmal – es war als Leerfläche eingezeichnet. Innen waren
politische Gefangene bis in die 1950er-Jahre in bunkerähnlichen Verließen eingekerkert. Körperliche Misshandlungen und Isolation waren an der Tagesordnung. Später, ab den 1960er Jahren, ersetzten perfide
psychologische Vernehmungsmethoden die physische Gewalt. Das Ziel der Vernehmer blieb das gleiche: Die mentale Zermürbung der Häftlinge. Rechtsstaatliche Verfahren gab es keine. Die Untersuchungshaftanstalt Berlin-Hohenschönhausen
war das größte Gefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Sebastian Skiba-Gutjahr hat die bedrückende Atmosphäre dieses Ortes fotografisch dokumentiert. Aufnahmen der Zellentrakte
und Vernehmungszimmer, des Haftkrankenhauses und der Hofgangzellen werden ergänzt durch Zeitzeugenporträts ehemaliger Häftlinge und erklärende Texte. Ein wichtiger Beitrag für die visuelle Erinnerungskultur
des Ortes.
Sebastian Skiba-Gutjahr, Jahrgang 1963, studierte Geschichte an der Universität Potsdam und machte danach eine Fotodesign-Ausbildung in Berlin.
Seit 2009 arbeitet er als Fotodesigner.
www.sebastianskiba.de
(vt) KTS 71
|
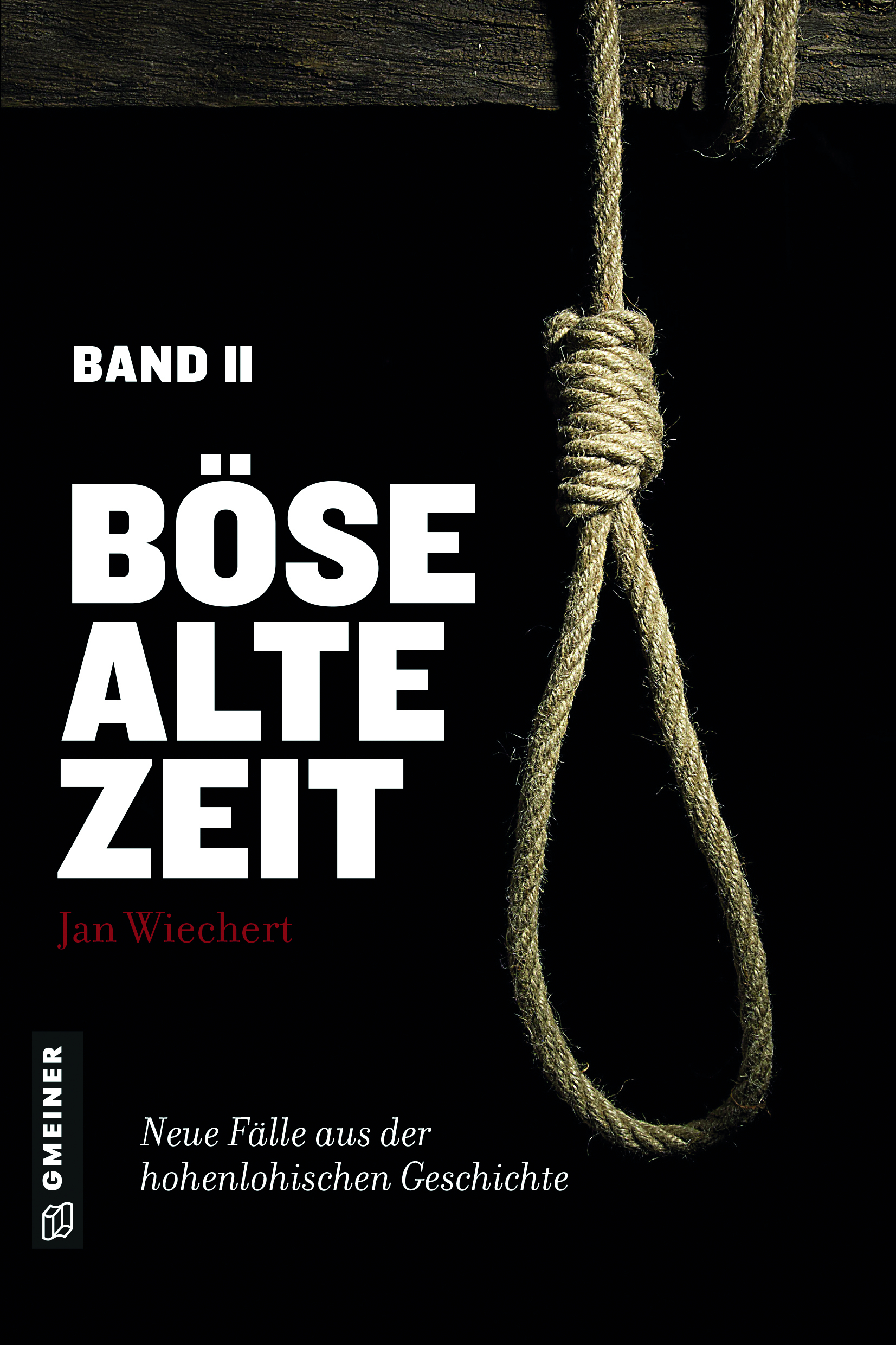
Wiechert, Jan:
Böse alte Zeit, Band II.
Neue Fälle aus der hohenlohischen Geschichte.
2021, 190 S., 21 Abbildungen, 1 Karte, Gmeiner-Verlag,
3-8392-2693-7 / 978-3-8392-2693-3, EURO 20,00
Schwarze Witwen und Beutelschneider, Galgenvögel und Kindsmörderinnen – die historische Überlieferung der Grafschaft Hohenlohe berichtet vielfach von Verbrechen
und ihrer juristischen Aufarbeitung. Sie erlaubt einen tiefen Blick in die sozialen Verhältnisse, die moralischen Vorstellungen und den martialisch anmutenden Strafvollzug einer angeblich guten alten Zeit. Anhand der
erhaltenen Dokumente aus drei Jahrhunderten überliefert auch der zweite Band von „Böse alte Zeit“ fesselnde Kriminalfälle der hohenlohischen Vergangenheit.
Inhalt:
Eine Hochzeit und ein Todesfall / Die Herrin der Fliegen / Mutterseelenallein / Der Bauern-Änderle / Galgenbau für Anfänger / Strafe unter Palmen / Ein Stich ins
Dunkle / Waldesruh / Karte / Anmerkungen des Autors / Literaturverzeichnis / Abbildungsverzeichnis / Quellenverzeichnis.
Jan Wiechert, 1982 in Riedlingen geboren, lebt heute in Öhringen. Die Geschichte der Region Hohenlohe, aber auch die allgemeine Rechts- und
Kriminalgeschichte gehören zu seinen Spezialgebieten. Seine Arbeit im Hohenlohe Zentralarchiv Neuenstein könnte abwechslungsreicher nicht sein: Sie reicht von der Erschließung historischer Dokumente über
die Tätigkeit im PR-Bereich bis hin zum Dozieren und Referieren zu Themen der hohenlohischen Geschichte. Neben zahlreichen Publikationen in regionalen Medien liegen von Jan Wiechert im Gmeiner-Verlag vor: „Böse
alte Zeit, Bd. I. Kriminalfälle aus der hohenlohischen Geschichte“, „Böse alte Zeit, Bd. II. Neue Fälle aus der hohenlohischen Geschichte“ und „Scheidung mit dem Beil. Das Schicksal der
Maria Dorothea Huther. Ein Kriminalfall des 18. Jahrhunderts“.
www.janwiechert.de
(vt) KTS 71
|
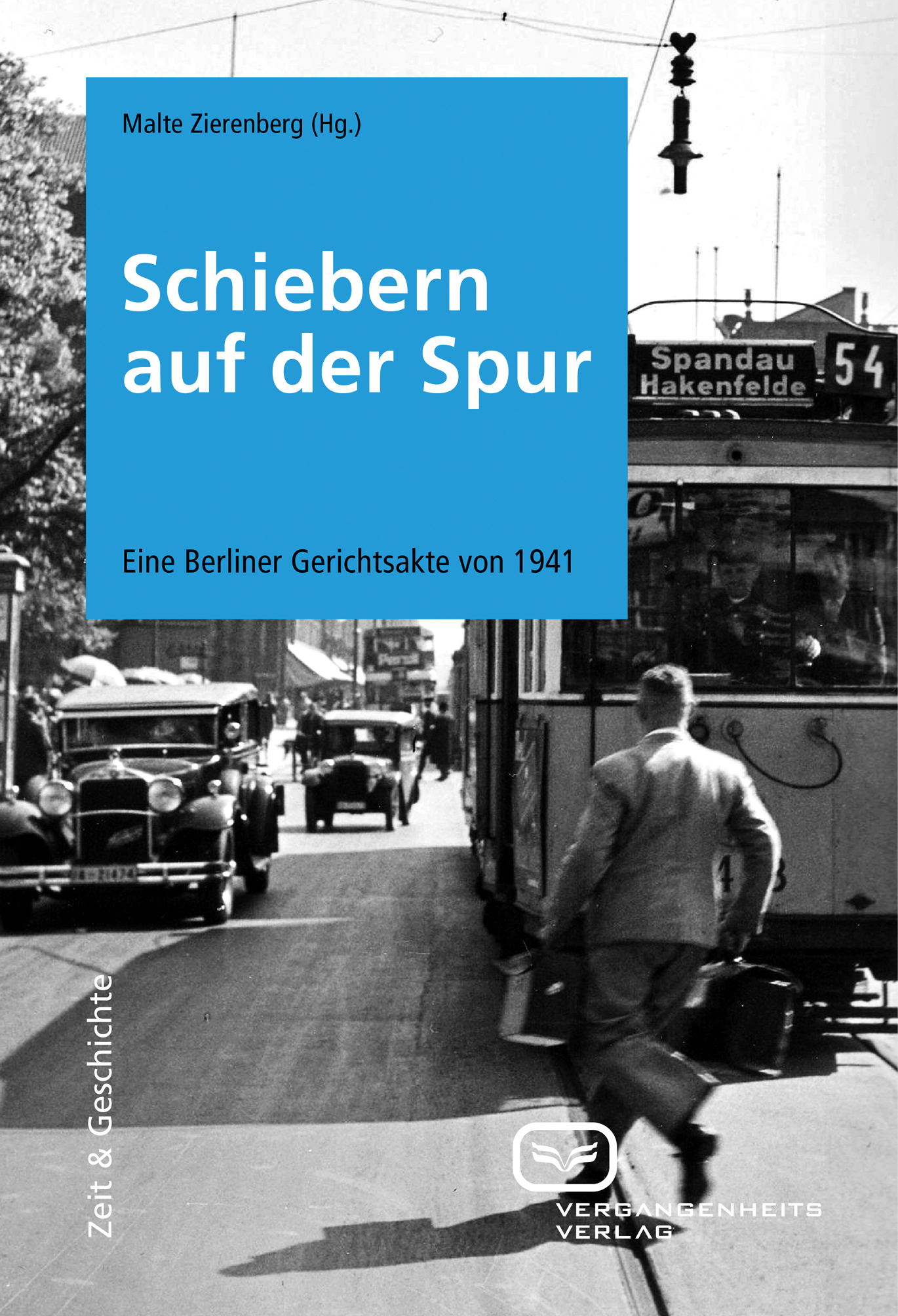
Zierenberg, Malte (Hg):
Schiebern auf der Spur.
Eine Berliner Gerichtsakte von 1941.
2011, 180 S., 20 Abbildungen, Vergangenheits Verlag, 3-940621-45-5
/ 978-3-940621-45-0, nur noch antiquarisch!
Nach 1945 sicherte der Schwarzmarkt das Übeleben vieler Deutscher. Doch die illegale Schattenwirtschaft prägte schon lange zuvor das NS-Reich; die „Schieber“
machten ihre Geschäfte – drakonisch bekämpft, aber kaum zu kontrollieren. Der Begriff „Schieber“ weckt heute viele Assoziationen: Männer mit hochgeschlagenen Mantelkragen, Zigaretten als Schwarzmarktwährung,
Drogen, Prostitution, Halbwelt. Aber das Buch über Schieber in Berlin ist keine weitere krimihafte Variante des „Dritten Mannes“. Die Realität ist spannender: Der Band konzentriert sich auf eine umfangreiche
Akte der Berliner Staatsanwaltscjaft aus der Kriegszeit. Anhand von Berichten der Kriminalpolizei, Verhörprotokollen aber auch Briefen und anderen Dokumenten rekonstruieren die Autoren den Fall eines Schiebers und seiner
Tauschpartner. Zugleich spüren sie den Kontexten der Geschichte nach und fragen nach der nationalsozialistischen Volksgemeinschaftsvorstellung, wie sie in den Dokumenten greifbar wird, nach der Rolle von Polizei und Justiz,
oder auch nach der Stadt als Raum eines illegalen Alltags, der bereits viele Jahre vor dem Kriegsende Berlin zu prägen begann.
Inhalt:
Michael Wildt: Vorwort / Sandra Grether: Der Fall Hans Reinsch / Christian Kollrich: Rahmenbedingungen. Kriegswirtschaft als verwalteter Mangel / Franziska Kelch: Die Kriegswirtschaftsverordnung
vom 4. September 1939 / Jan-Paul Hartmann: Ermittler auf Spurensuche. Die Kriminalpolizei an der „inneren Front“ / Clemens Villinger: Familiensache. Handelnde Personen, Aussagen und Motive / Desirée Brinitzer,
Patrik Daus, Johanna Kleinschrot & Juliane Roelecke: Im Koffer nach Berlin. Orte und Räume des Kaffeehandels / Katazyrna Kloskowska & So Yeon Kim: Der notwendige Luxus – Kaffee in der Kriegsgesellschaft
/ Peter Krumeich: Allgegenwärtig. Den Krieg in der Akte finden / Franziska Kelch: Vor dem Richter. Geschichte, Funktion und Praxis des Sondergerichts / Bernd Kessinger & Tim Schenk: Partizipation und Ausschluss in
der NS-Gesellschaft / Aktenauszüge / Malte Zierenberg: Probleme und Chancen eines Quellen- und Forschungsprojekts – ein Rückblick / Anhang.
Malte Zierenberg, Jahrgang 1975, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität
zu Berlin. Seine Dissertation „Stadt der Schieber. Der Berliner Schwarzmarkt 1939-1950“ erschien 2008.
(vt) KTS 71
|
Essen & Trinken
Schauplätze
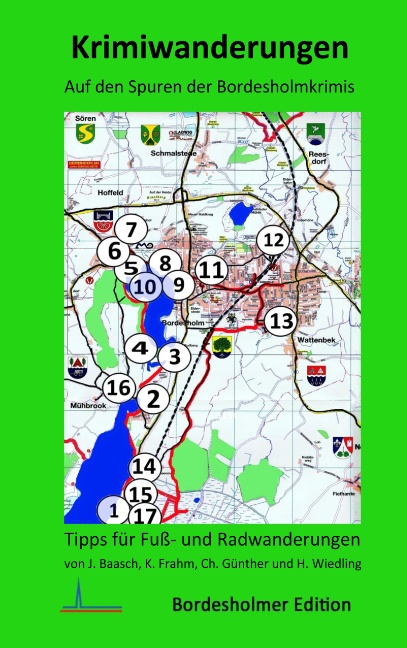
Baasch, Jürgen / Frahm, Kirsten / Günther, Charlotte / Wiedling, Hartmut:
Krimiwanderungen.
Auf den Spuren der Bordesholmkrimis.
Tipps
für Fuß- und Radwanderungen.
2014, 52 S., 3 farbige Karten, farbige Abbildungen, Books on Demand (Bodesholmer Edition, Bd. 13), 3-7357-5979-3 / 978-3-7357-5979-5, EURO 4,90
2003 gründeten Hartmut Wiedling, BWL-Professor, und Jürgen Baasch, ehemaliger Bürgermeister von Bordesholm, die Bordesholmer Edition. Innerhalb dieser Edition erschien
2012 der erste von bis heute zwölf Kriminalromanen, die in der Region um Bordesholm – zwischen Kiel und Neumünster in Schleswig-Holstein gelegen - angesiedelt sind. Zu Wiedling und Baasch gesellten sich Kirsten
Frahm und Charlotte Günther. Hauptsächlich diese vier AutorInnen verantworten die sogenannten Bordesholmkrimis. Nach „Das Grab auf der Insel“ (Bordesholmkrimi 1), „Schmalsteder Beifang“ (BK
2) und „Lotosblüte“ (BK 3) legten die Vier ein schmales Büchlein „Krimiwanderungen – Auf den Spuren der Bordesholmkrimis“ vor. Die Druckfinanzierung erfolgte ganz offensichtlich durch
Einwerbung von Anzeigen lokaler und regionaler Geschäftsleute (Buchhandlung, Hotels, Restaurants, Handwerker etc). Von Anfang an waren die AutorInnen darauf bedacht, ihre Kriminalromane so zu schreiben und gestalten,
dass für das Lesepublikum ein äußerst hoher Wiedererkennungswert entstand: „Regionalkrimis sollten es sein, die das Autorenteam den Lesern präsentierte. Plätze, Fluchtwege, Verstecke und Tatorte
wurden über das Bordesholmer Land verstreut“ (aus dem Vorwort der Autoren). Diese „Krimiwanderungen“ folgen den Spuren von Kommissar Bielfeld und seiner Assistentin Erika Friedberg in den ersten drei
Bordesholmkrimis. Jede wichtige Landmarke, jeder markante Punkt oder einschlägige Adressen im Bordesholmer Land werden aufgezeigt und mit Textauszügen und Zitaten aus den drei Krimis ergänzt. Für Leser
der Bordesholmkrimis wahrscheinlich der Beweis für die Richtigkeit der entsprechenden Krimitopographie, für Urlauber in der Region Bordesholm eventuell Anreiz ein Blick in diese Krimis zu werfen. Die Bordesholmkrimis
werden übrigens jedes Jahr am Totensonntag um 17.00 Uhr mit einer Premierenlesung vorgestellt. Der 12. Bordesholmkrimi liegt als druckfertiges Manuskript bereits vor. Ein Folgeband der „Krimiwanderungen“ ist
nicht erschienen und bisher auch nicht geplant.
Inhalt:
Grußwort des Amtsdirektors Heinrich Lembrecht / Vorwort der Autoren / Krimi I: Das Grab auf der Insel / Krimi II. Schmalsteder Beifang / Krimi II: Lotosblüte.
Jürgen Baasch, geboren 1945, war bis 2004 Bürgermeister in Bordesholm. Heute leitet er unter anderem
Seminare in Plattdeutsch.
Hartmut Wiedling, geboren 1940, war bis 2003 Professor für BWL an der Fachhochschule Kiel. Seit seinem Ruhestand
veröffentlichte er neben einem Kriminalroman, einen gesellschaftskritischen Zukunftsroman, einen Erzählband, einen satirischen Roman und ein Bühnenstück.
(tp) KTS 71
|
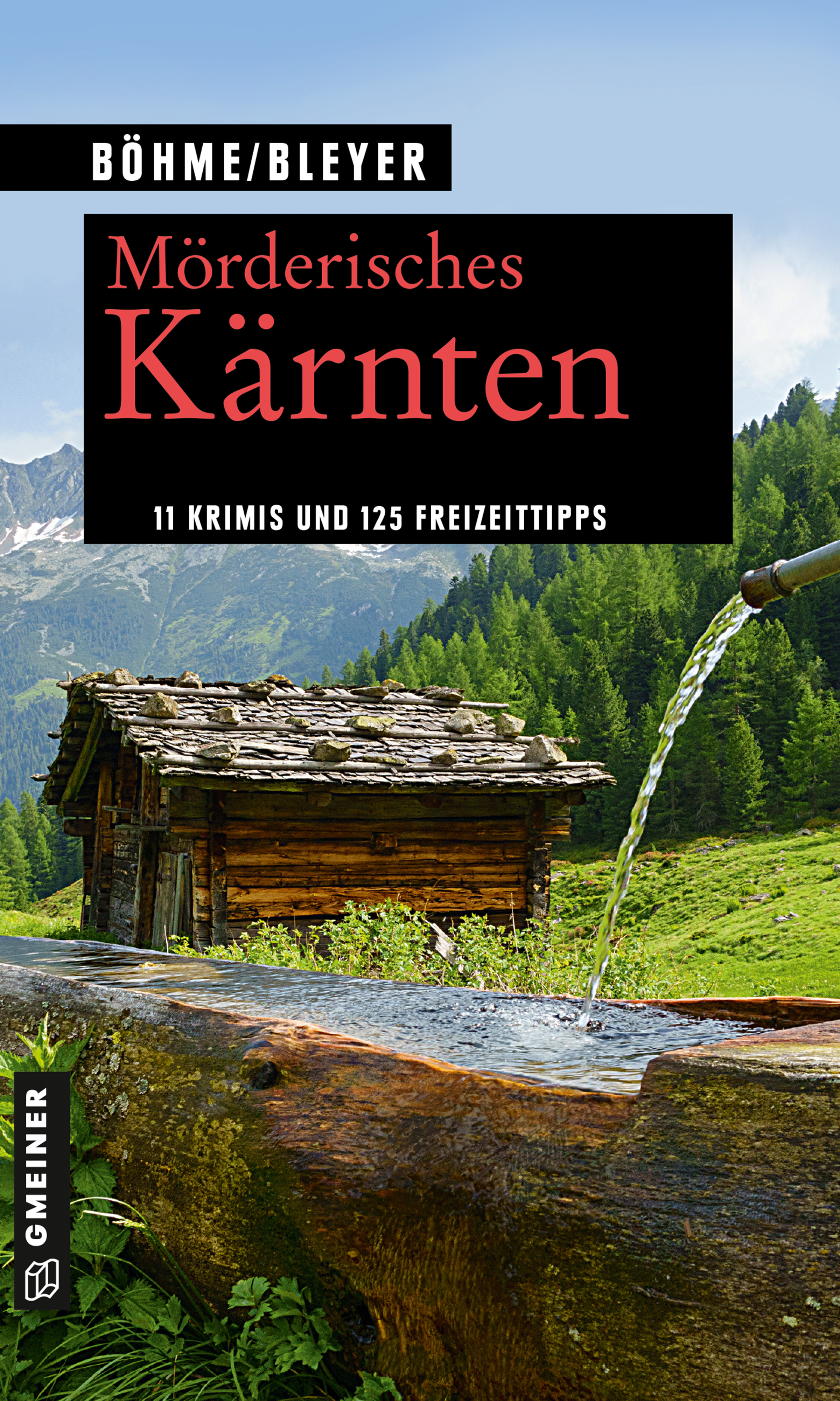
Böhme, Dorothea / Bleyer, Alexandra:
Mörderisches Kärnten.
11 Krimis und 125 Freizeittipps.
2021 (Neuauflage der Ausgabe von 2015), 283 S., 1 Übersichtskarte
Kärnten, Gmeiner-Verlag, 3-8392-2894-8 / 978-3-8392-2894-4, EURO 11,50
In den Kulissen von Klagenfurt, Villach, St. Veit, Ferlach, Großglockner, Weißensee oder Millstätter See lassen die Autorinnen Böhme und Bleyer gute und weniger
gute Zeitgenossen auftreten. Da ist z.B. Irene Weratschnig, die kettenrauchende Polizistin löst trotz starken Raucherhustens stets die ihr übertragenen Fälle, wohingegen die Kleinkriminelle Wilma Brandstätter
immer wieder über Leichen stolpert. Wie üblich in der Reihe „Mörderisches …“ werden diese 11 Kurzkrimis mit ausführlichen Freizeittipps und Hinweisen auf 125 Sehenswürdigkeiten des
südlichsten Bundeslandes der Republik Österreich ergänzt.
Dorothea Böhme, geboren 1980, zieht es immer wieder in die weite Welt hinaus: Italien, Ungarn und Ecuador waren unter
anderem Stationen in ihrem Leben. Einige Jahre verbrachte sie auch im wunderschönen Kärnten, das sie schnell in ihr Herz schloss und zum Schauplatz ihrer skurrilen Kriminalromane um den Chefinspektor Fritz Reichel
machte.
www.dorotheaboehme.de
Alexandra Bleyer, promovierte Historikerin, geboren 1974, ist Sachbuchautorin, Kulturjournalistin und Krimileserin.
Die gebürtige Klagenfurterin lebt in Seeboden am Millstätter See und ist auch für die Freizeittipps dieses Buches verantwortlich.
www.alexandrableyer.at
www.das-syndikat.com/autoren/autor/4695-alexandra-bleyer.html
(tp) KTS 71
|
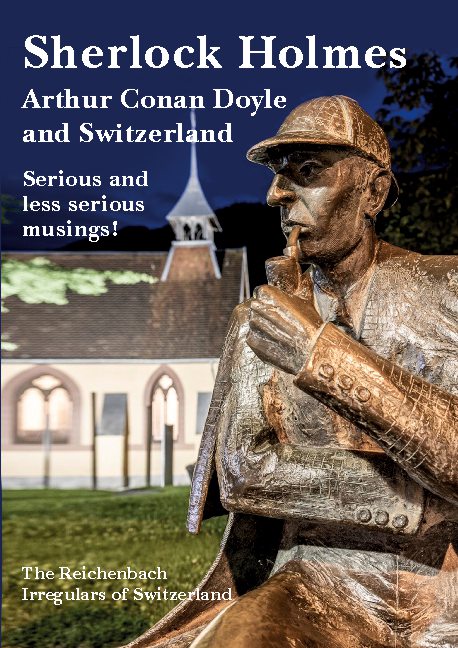
Geisser, Marcus / Marriott, Guy / Meer, Michael A. (Hg):
Sherlock Holmes.
Arthur Conan Doyle and Switzerland.
Serious and less serious musings
from The Reichenbach Irregulars of Switzerland,
2021, 112 S., zahlreiche s/w und farbige Fotos und Abbildungen, Karten, Books on Demand, 3-7534-6179-2 / 978-3-7534-6179-3, EURO 21,00
Ungebrochen ist seit Erscheinen des ersten Werkes die Faszination der Leser am weltweit meist bekanntesten Detektiv Sherlock Holmes und seines Sidekicks Dr. John Hamish Watson,
erschaffen von Arthur Conan Doyle. Weltweit gibt es seit je her Vereinigungen und Verbindungen, die sich dem Gesamtwerk des Briten verschrieben haben und die untereinander gut vernetzt sind. In der Schweiz sind es „The
Reichenbach Irregulars of Switzerland“, deren Mitglieder sich nach den berühmt-berüchtigen Reichenbach Fällen benannt haben und sich Mitte 1989 gründeten. Seit 1990 treffen sich die Mitglieder mehr
oder weniger regelmäßig einmal pro Jahr, seit 2000 organisieren sie international besuchte Konferenzen. Im Mai dieses Jahres ist das erste Buch der Reichenbach Irregulars of Switzerland erschienen. In „Sherlock
Holmes. Arthur Conan Doyle and Switzerland“ versammeln die drei Herausgeber Vorträge, die 1997, 2014 und 2017 auf diesen Konferenzen gehalten wurden. Wie schon im Untertitel dieser Sammlung erläutert, handelt
es sich dabei um ernsthafte und weniger ernsthafte Überlegungen zur Beziehung Doyles respektive seines Protagonisten zur Schweiz. In fünf Teilen gliedern die Herausgeber diese üppig bebilderte Essaysammlung,
die sie einem interessierten breiteren Publikum vorstellen. Die verschiedenen Artikel und Analysen dürften nicht nur Sherlock-Holmes-Fans beeindrucken, sondern werden wahrscheinlich auch neue Mitglieder für die Reichenbach
Irregulars werben. Der erste Teil berichtet über verschiedene Gebirgspässe die Holmes auf seiner Reise nach Florenz gequert haben könnte, was er in Florenz unternommen hat sowie es den verkleideten Holmes nach
Tibet verschlagen hat. Teil 2 beschäftigt sich mit Holmes‘ Verbindungen zur Schweiz, beinhaltet eine literarische Exkursion über Holmes Rennwagenmotor im Vergleich zum Schwerölmotor von Glausers Wachtmeister
Studer und erläutert eine Recherche zur weltweit ersten Holmes-Gedenktafel bei den Reichenbach Fällen. Teil 3 vertieft in verschiedenen Essays Holmes Beziehungen zu den Schweizer Alpen. Teil 4 führt noch einmal
zurück zum Ausgangspunkt dieser Essaysammlung, zu den Reichenbach Fällen. Fast alle Artikel werden durch mehr oder weniger umfangreiche Bibliographien weiterführender Literatur ergänzt. Einziges Manko in
meinen Augen ist das unglücklich gewählte Format (DIN A 4) der Sammlung. Ein kleineres Format und ein stärkerer Buchumschlag hätten „Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle and Switzerland“ gut
zu Gesicht gestanden.
Inhalt:
--- I. Introduction
Peter E. Blau: „It Was a Lovely Trip …“.
--- II. Reichenbach and Beyond
Eva Zenk Iggland: The Missing Mountain Guide / Guy Marriott: The many routes from the Reichenbach Falls / Bryan Stone: A Study in Prohabilities and Realities / Enrico Solito: The
Florentine Sherlock / Catherine Cooke: Towards a Forbidden Land of the Holy Books.
--- III. Stories for which the world is now prepared
Marina Stajić: The Mystery of Adelheid Halm / Reinhard Hillich: Holmes and Studer – An engine comparison / Marina Stajić: The Baden Dilemma? / Julie McKuras: A
Fixed Point.
--- IV. „We are coming to Switzerland (…). There is beautiful atmosphere in these hights.“
Marcus Geisser: Adventures & Amusements in Alpine Heights – Arthur Conan Doyle, the Alps and the Swiss / Michael A. Meer: „It is, indeed, a fearful place“:
On Conan Doyle and Switzerland / Jon Lellenberg & Daniel Stashower: „The Best or the Worst Thing I Ever Wrote“: A. Conan Doyle and The Stark Munro Letters / Clifford S. Goldfarb: The Brigadier in Switzerland:
Travels with Arthur and Napoleon / Marcus Geisser: The Final Return.
--- V. Afterword
Akane Higashiyama & Mitch Higurashi: „Well, it was a pleasant talk“.
--- VI. Biographies of authors
Marcus Geisser, ursprünglich aus der Schweiz, lebt heute in Großbritannien. Marcus Geisser ist Gründungsmitglied
und erster Präsident der „The Reichbach Irregulars of Switzerland“, der ersten Schweizer Sherlock Holmes Gesellschaft, gegründet im Sommer 1989. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen gehören
u.a. „Start her up, Watson – Pferdestärken im Kanon“ (in: Mobile Holmes, The Baker Street Irregulars, New York 2017) und „Conan Doyle und Spione – Wer war von Bork?“ (in: The Sherlock
Holmes Journal, 2014). Zusammen mit Michael A. Meer war Marcus Geisser Architekt und Mitorganisator der Reichenbach Irregulars-Konferenzen 2014, 2017 und 2019. Marcus Geisser ist auch Mitglied der Baker Street Irregulars of
New York.
Guy Marriott aus Großbritannien war bis vor kurzem Vorsitzender und Präsident der Sherlock Holmes
Society of London und ist u.a. Mitglied der Baker Street Irregulars of New York. Er ist außerdem Schirmherr des London Transport Museum und Vizepräsident des London Bus Museum.
Michael A. Meer, aktueller Präsident der Reichenbach Irregulars, ist seit seiner Kindheit ein Sherlockianer.
Zu seinen jüngsten Beiträgen gehört „Das Spiel spielen“ und die Wahrheit über „Sein letzter Bogen“ für die Baker Street Irregulas of New York-Serie „Trenches – The
War Service of Sherlock Holmes“ (2017).
The Reichenbach Irregulars of Switzerland ist die erste Schweizer Sherlock Holmes Gesellschaft, die am 24. Juni 1989 in Meiringen von einer Gruppe junger Sherlockianer unter der Leitung von Marcus Geisser gegründet wurde. In den 1990er Jahren organisierten
The Reichenbach Irregulars Treffen in der Schweiz und in Süddeutschland, veröffentlichten ein Journal „The Reichenbach Journal“ und den Newsletter „The Young Swiss Messenger“. Seit dem Jahr
2000 organisieren die Reichenbach Irregulars internationale Experten-Konferenzen über Sherlock Holmes und Arthur Conan Doyle. Diese Meetings finden regelmäßig in Schweizer Alpenorten statt und werden von einem
Publikum aus aller Welt besucht.
www.221b.ch
(tp) KTS 71
|

Küpper, Michaela:
Entlang der Sieg.
Zauberhafte Ausflugsziele, versteckte Naturoasen, Freizeitspaß für Familien.
2021 (1. überarbeitete Neuauflage der Ausgabe
von 2012), 85 S., zahlreiche Farbfotos, 2 Übersichtskaren, Gmeiner-Verlag (Lieblingsplätze), 3-8392-2930-8 / 978-3-8392-2930-9, EURO 17,00
Der Rhein-Sieg-Kreis ist beliebter Tatort vieler Kriminalautorinnen und –autoren aus dem Bonner Raum und – natürlich – aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Die in Königswinter
am Rhein lebende Autorin und Redakteurin Michaela Küpper hat unter anderem mit „Witwenrallye“, „Wintermorgenrot“ und „Wildwasserpolka“ Krimis entlang der Sieg vorgelegt mit der jungen
Privatdetektivin Johanna Schiller. Handlungsorte sind, von Siegburg ausgehend, Städtchen, Dörfer, Sehenswürdigkeiten und Ausflugsorte, die sich am Flußlauf der Sieg befinden. Bereits 2012 erschien Küppers
Reiseführer „Entlang der Sieg“, in dem sie ihre Lieblingsplätze und Ausflugsziele beschreibt. „Cannibalising“ ist eine nette Metapher für die Wiederverwertung von Texten. Für die
„Settings“ in ihren oben genannten Krimis hat sie ihren Reiseführer „Entlang der Sieg“ kannibalisiert. Wer also zeitgleich mit der Lektüre von „Witwenrallye“, „Wintermorgenrot“
oder „Wildwasserpolka“, die Flucht- und Ermittlungsroute der Privatdetektivin Johanna Schiller entlang der Sieg verfolgen und dabei die Orte, Plätze und Lokalitäten mit den Augen der Privatdetektivin
sehen möchte, dem sei die überarbeitete und ergänzte Neuauflage dieses „Krimi-Reiseführer“ empfohlen.
Michaela Küpper ist freie Autorin und blickt auf zahlreiche Veröffentlichungen zurück. Sie wurde im niederrheinischen Alpen geboren
und ist in Bonn aufgewachsen. Sie studierte in Marburg Soziologie, Psychologie, Politik und Pädagogik. Bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete, arbeitete sie viele Jahre lang als Verlagsredakteurin und Projektmanagerin.
An den Wochenenden ist sie gern mit ihrer Familie an der Sieg zu Gast. Zu Wasser und zu Lande, mit dem Kanu, dem Wohnmobil, dem Fahrrad und in Wanderschuhen hat sie die Region erkundet. Heute lebt sie mit ihrer Familie in
Königswinter. Neben zahlreichen Kinderbüchern und Kurzkrimis sind von ihr auch drei Kriminalromane sowie die Serie „Mord in Richman Hall“, „Mord im Weißwurststüberln“ und „Mord
in der Villa Mafiosa“ erschienen.
www.michaelakuepper.de
www.das-syndikat.com/autoren/autor/413-michaela-kueppe.html
(tp) KTS 71
„8 Fragen an Michaela Küpper“ siehe KTP 127
*****
|
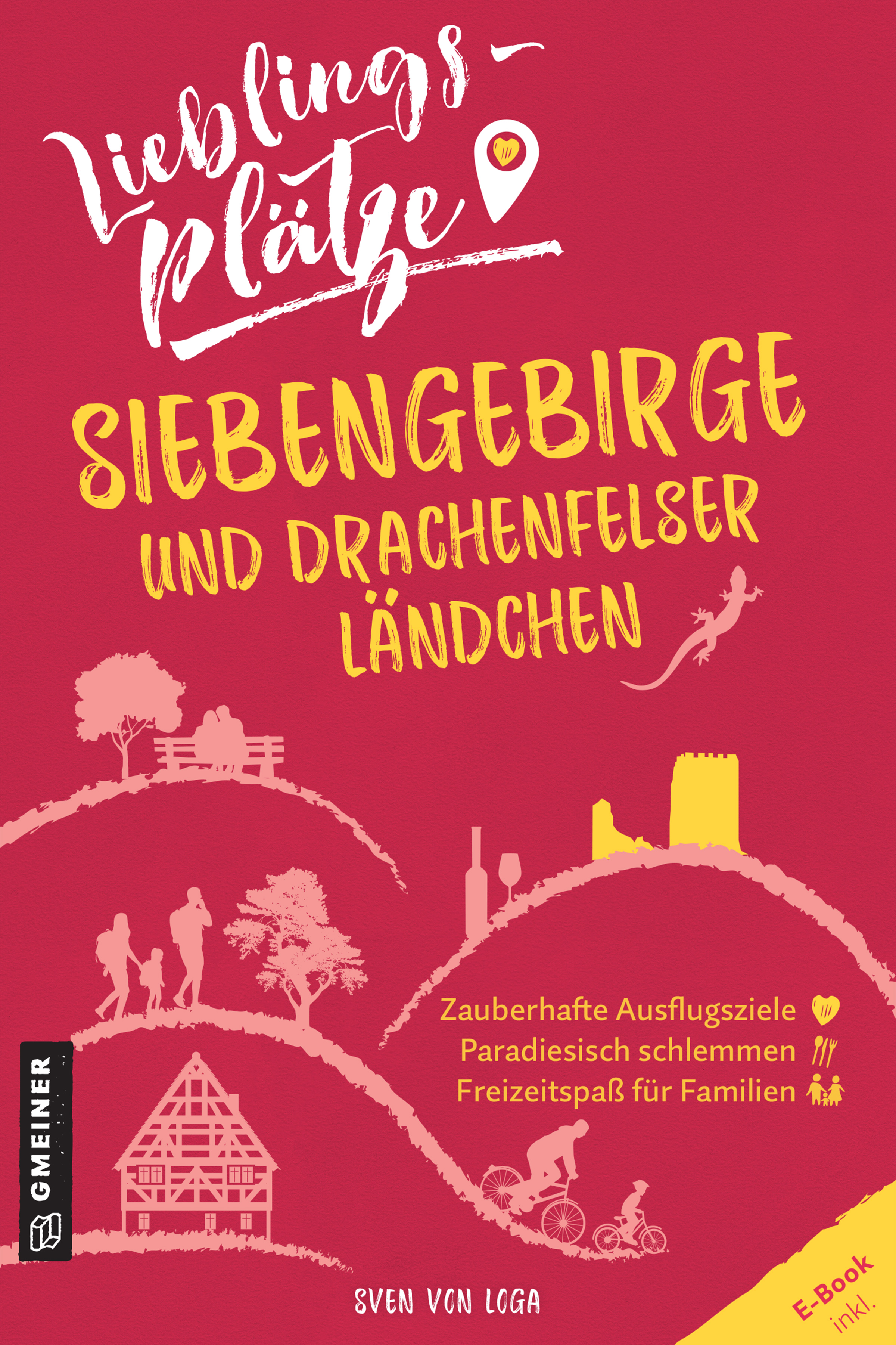
Loga, Sven von:
Siebengebirge und Drachenfelser Ländchen.
Zauberhafte Ausflugsziele, paradiesisch schlemmen, Freizeitspaß für
Familien.
2021 (1. Überarbeitete Neuauflage der Ausgabe von 2019), 189 S., 1 Übersichtskarte Region Siebengebirge und Drachenfelser Ländchen, Gmeiner-Verlag (Lieblingsplätze), 3-8392-2885-9 / 978-3-8392-2885-2,
EURO 17,00
Das Siebengebirge und das Drachenfelser Ländchen sind rechts- und linksrheinische Naherholungs- und Naturschutzgebiete, welche die Einwohner der Bundesstadt Bonn und der umliegenden Gemeinden gerne
nutzen. Aber auch Touristen aus dem Ausland strömen in die Region – nicht umsonst trägt der Drachenfels hoch über dem Rhein auch augenzwinkernd den Titel „höchster Berg Hollands“. Aber
nicht nur Frohsinn prägt das Siebengebirge. In zahlreichen Kriminalromanen ist das Siebengebirge Kulisse für Mord und Totschlag, z.B. „Fehltritt im Siebengebirge“ (Kristan, 1986) oder „Der versteinerte
Engel“ (Kirscht, 2001). JR lässt seinen Privatdetektiv Jan van Ridder in Bad Godesberg ermitteln oder Egarezzo (d.i. Wolfgang W. Osterhage) und Judith Merchant verorten ihr setting auf und beim Drachenfels in „Drachenrad“
(2016) und „Nibelungenlied (2011). Und auch der Ennert ist Kulisse für Mord und Totschlag, „Die Toten vom Ennert“ (Büchel) – um nur einige wenige der vielen in dieser Region spielenden Kriminalromane
zu nennen. Selbstverständlich ist auch die ehemalige Haupt- und jetzige Bundesstadt Bonn Schauplatz vieler Kriminalromane. Wer gerne Krimis aus Bonn und der Region liest, dem seien die 88 Hinweise zu den verschiedenen
Örtlichkeiten des Siebengebirges und des Drachenfelser Ländchens von Sven von Loga empfohlen. Jeder Ort des ältesten deutschen Naturschutzgebietes, den Loga auf einer Buchseite beschreibt, wird durch ein aussagekräftiges
Foto illustriert und mit Anschrift, Telefonnummer und Homepage ergänzt.
Sven von Loga besuchte das Siebengebirge erstmals vor über 30 Jahren als Kölner Geologiestudent – und ist ihm seither verfallen. Keine Landschaft rund um Köln
ist erdgeschichtlich und kulturhistorisch so vielfältig und abwechslungsreich wie das Siebengebirge. Der Autor führt seit Jahren Geo-Exkursionen durch diese urtümliche Naturlandschaft und ist den Wundern der
Region in zahlreichen Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln auf den Grund gegangen.
www.uncites.de
(tp) KTS 71
|
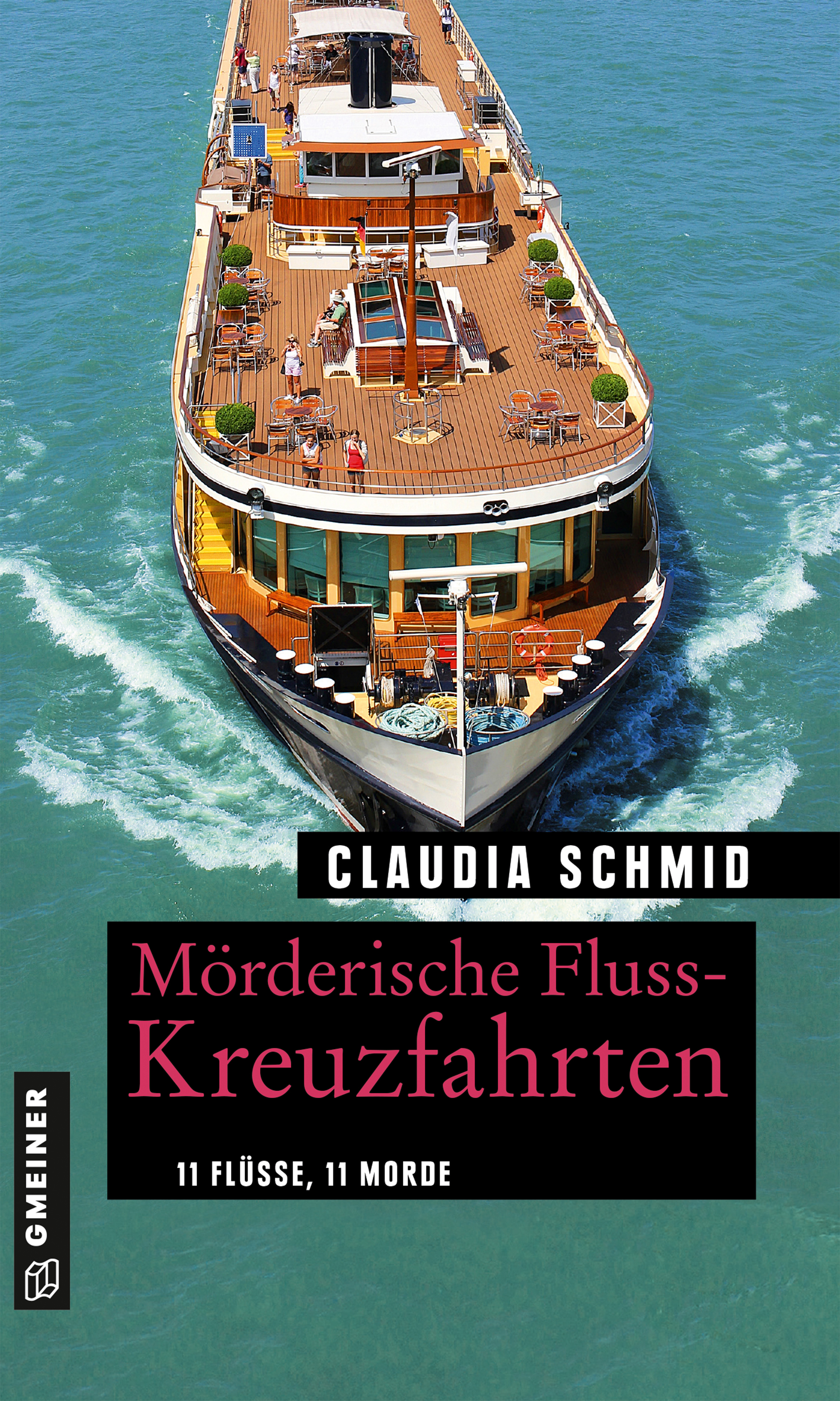
Schmid, Claudia:
Mörderische Fluss-Kreuzfahrten.
11 Flüsse, 11 Morde.
2020, 283 S., 1 Karte, Gmeiner-Verlag, 3-8392-2738-0 / 978-3-8392-2738-1,
EURO 12,00
Die Hobby-Ermittler Edelgard und Norbert werden von Claudia Schmid auf ausgedehnte Kreuzfahrten auf den beliebtesten Flussstrecken Deutschlands geschickt. Die beiden starten ihre
erste Kreuzfahrt in Passau (Donau), statten Dresden und Prag einen Besuch ab (Elbe), folgen der Ems, schippern über Main und Rhein, machen Station in Berlin (Spree und Havel) und beenden schließlich ihre ausgedehnten
Erkundungen in Sankt Peter Ording (Eider). Und sie wären nicht Edelgard und Norbert, stolperten sie nicht über mannigfältige Kriminalfälle, denen sie auf den Grund gehen müssen. Zudem sind auch noch
diverse Leichen mit von der Partie, die den erhofften unbeschwerten Flusskreuzfahrten ein gewisses Hautgout geben. In elf Kurzkrimis zeichnet Claudia Schmid die verschiedenen Wasserwege Deutschlands nach und läßt
ihre Hobby-Detektive Sehenswürdigkeiten entlang ihrer Reisen von Passau bis Flensburg erkunden.
Inhalt:
Passau for ever (Donau) / Vom Ende einer Ehe (Elbe) / Eine Leiche zum Dessert (Ems) / Wenn sie doch bloß geschwiegen hätte (Iller) / Tattoos und Wolkenkratzer (Main)
/ Die Beobachterin (Neckar) / Der runde Geburtstag (Spree und Havel) / Als Norbert für den Film entdeckt wird (Rhein) / Ein ganz besonderer Saft (Saar) / Wo die Liebe hinfällt (Mosel) / Der Vogelretter (Eider).
Claudia Schmid lebte in Passau, bevor sie sich ihren Traum erfüllte und an der Mannheimer Universität Germanistik studierte. Seit 30
jahren wohnt die Ehren-Kriminalkommissarin in der Metropolregion Rhein-Neckar nahe Heidelberg und schreibt Kriminelles, Historisches und Reiseberichte. Die mehrfach ausgezeichnete Autorin ist auch als Redakteurin von „kriminetz.de“
sowie als Kommunikationstrainerin tätig.
www.claudiaschmid.de
www.das-syndikat.com/autoren/autor/486-claudia-schmid.html
www.kriminetz.de
(tp) KTS 71
„8 Fragen an Claudia Schmid“ siehe KTS 68
*****
|
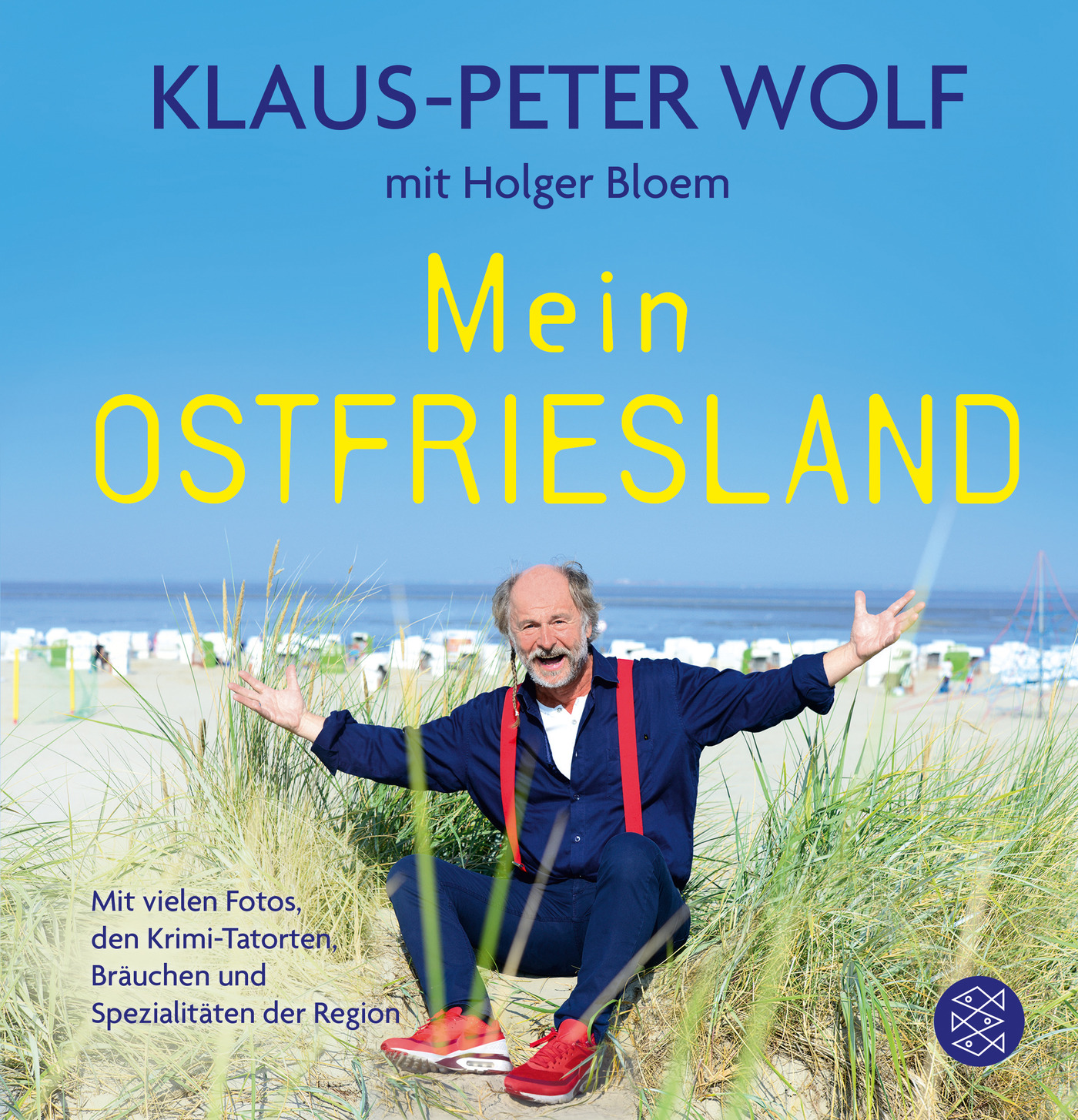
Wolf, Klaus-Peter / Bloem, Holger:
Mein Ostfriesland.
2019, 256 S., zahlreiche Fotos, 1 Karte Ostfriesland, Fischer Taschenbuch 70435, 3-596-70435-9
/ 978-3-596-70435-4, EURO 18,00
Klaus-Peter Wolf, einer der beliebtesten und fleißigsten deutschen Krimiautoren, stellt seine Wahlheimat Ostfriesland seinen Lesern in einem üppig illustrierten Text-/Bildband
vor. Dort, wo seine Kriminalkommissarin Ann Kathrin Klaasen ihrem Dienst nachgeht und ermittelt, nimmt Klaus-Peter Wolf seine Leser an die Hand und präsentiert ihnen all die Schauplätze, die in seinen Kriminalromanen
eine Rolle spielen. Das Watt und Meer, oder die Inselkette von Borkum bis Wangerooge sind aus seinen Romanen den Lesern wohlbekannt. Jetzt haben Wolf-Fans die Gelegenheit anhand dieses Text-/Bildbandes in zwölf Kapiteln
einen genauen Blick auf die Landschaft, die Bräuche und die Spezialitäten der Region zu werfen. Eingestreut sind Steckbriefe von Protagonisten seiner Romane, Klaus-Peter Wolfs Freunden, die als Nebendarsteller in
kleinen oder größeren Rollen in seinen Krimis auftauchen. Garniert wird alles mit Zitaten und Textpassagen aus den Krimis, Rezepten der ostfriesischen Spezialitäten und Erläuterungen zum Brauchtum der
Region. Für „Mein Ostfriesland“ hat sich Klaus-Peter Wolf der Mitarbeit von Holger Bloem, Journalist und langjähriger Freund (der auch immer wieder in seinen Romanen eine Rolle spielt), versichert.
[Wer sich über die Neuerscheinungen der Ostfriesenkrimis
von Klaus-Peter Wolf informieren möchte, sollte einen
Blick in das Extrablatt „Ostfrieslandkrimis – Klaus-Peter
Wolf Zeitung“ werfen. Siehe den Hinweis dazu im Kapitel
„Jahrbücher / Zeitschriften“.]
Inhalt:
--- Klaus-Peter Wolf: Vorwort / Holger Bloem: Einleitung.
--- 1. Norden: Der erste Fall für Ann Kathrin Klaasen, „Ostfriesenkiller“ / Steckbrief Ann Kathrin Klaasen / Auf den Spuren von Ann Kathrin Klaasen – Mörderische
Stadtführung durch Norden / Klaus-Peter-Wolf-Menü / Brauchtum – Bogenmachen.
--- 2. Norden – Norddeich: Norddeich-Mole / Ein Leben zwischen Marzipan und Zuckerguss – Das Norder „Café ten Cate“ wird in fünfter Familiengeneration
geführt / Steckbrief Jörg Tapper / Steckbrief Monika Tapper / Ostfriesisches Brauchtum – Puppvisiet.
--- 3. Schloss Lütetsburg: Schlosspark Lütetsburg / „Mensch, Sie gibt es wirklich?“ / Steckbrief Peter Grendel / Rezept - Ritas Grünkohl mit Pinkel /
Ostfriesisches Brauchtum – Der Maibaum.
--- 4. Spiekeroog: Steckbrief Rita Grendel / Rezept – Matjestopf / Ostfriesisches Brauchtum – Boßeln.
--- 5. Borkum: „Träume sind der Schlüssel zum Glück“, sagt eine bekannte Lebensweisheit … / Bettina Göschl „Wenn mein Mann einen neuen
Krimi schreibt“ / Ostfriesisches Brauchtum – Walfang / Steckbrief Holger Bloem / Rezept – Ostfriesentorte mit Branntweinrosinen.
--- 6. Norderney: Rezept – Labskaus / Steckbrief Frank Weller / Ostfriesisches Brauchtum – Der Seemanns-Ohrring.
--- 7. Das Moor: Guselgeschichten im Moor (1) / Gruselgeschichten im Moor (2) / Steckbrief Rupert / Ruperts Lieblingsrezept – Currywurst, auch Manta-Teller genannt / Das
Teemuseum in Norden / Ostfriesisches Brauchtum – Die Tee-Zeremonie.
--- 8. Watt und Strand: Steckbrief Bettina Göschl / Ostfriesisches Brauchtum – Paaskefüür / Rezept – Hochzeitssuppe / Bettina Göschl „Ostfriesenblues“.
--- 9. Emden, Greetsiel, Neßmersiel: Kein Schiffbruch mit Wolf [Interview] / Steckbrief Dr. Uwe Rosenfeld / Rezept – Updrögt Bohnen (Bohnen am Band) / Ostfriesisches
Brauchtum – Klinkenputzen und Fegen.
--- 10: Langeoog: Schöner Morden im Norden / Steckbrief Klaus-Peter Wolf / Empfehlung – Sanddorn Dickmilch bei Dagmar Falke in der Meierei / Rezept – Sanddorn-Gelee
/ Ostfiesisches Brauchtum – Verknobelung.
--- 11. Wangerooge: Steckbrief Ubbo Heide / Ostfriesisches Brauchtum – Sünnerklaas / Holger Bloem „Hauptsache, der Deich hält“ / Rezept – Snirrtjebraa.
--- 12. Das Abenteuer geht weiter!: Klaus-Peter Wolf „Er lässt mich nicht los!“ / Steckbrief Dr. Bernhard Sommerfeldt.
--- Die Verfilmung / Die Freunde.
Klaus-Peter Wolf, in Gelsenkirchen geboren, lebt seit vielen Jahren als freier Schriftsteller in Ostfriesland.
Hier entstehen seine Kriminalromane mit Kommissarin Ann Kathrin Klaasen oder auch mit dem Serientäter Dr. Bernhard Sommerfeldt, die immer wieder den Sprung auf Platz 1 der Bestsellerliste schaffen. Und hier leben auch
einige seiner Romanfiguren tatsächlich.
www.klauspeterwolf.de
www.das-syndikat.com/autoren/autor/306-klaus-peter-wolf.html
Holger Bloem, in Emden geboren, ist Journalist und Chefredakteur des Ostfriesland-Magazin. Er ist langjähriger
Weggefährte von Klaus-Peter Wolf und taucht immer wieder in seinen Romanen auf.
www.osfriesland-magazin.de/index.php/ostfriesland-magazin/redaktion
(tp) KTS 71
„8 Fragen an Klaus-Peter Wolf“ siehe KTP 131
|
Jahrbücher
Zeitschriften
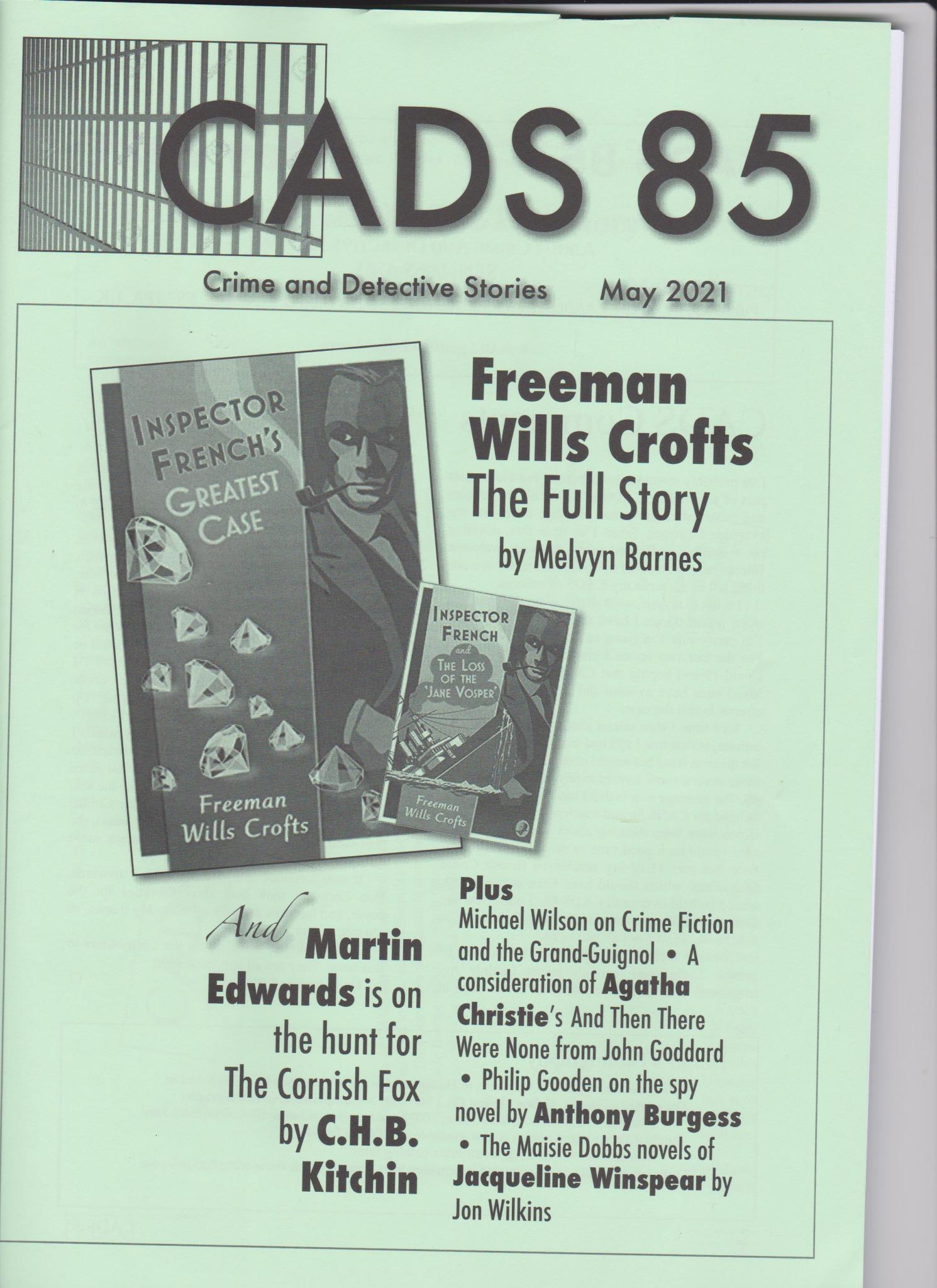
Bradley, Geoff / Cornwell, Bob (Hg): CADS – An Irregular Magazine of Comment and Criticism About Crime and Detective Fiction. 2018, 80 Seiten,
s/w Illustrationen, CADS, ISSN 0965-6561, £ 9,00 je Ausgabe [Bezugsanschrift: Geoff Bradley, 9 Vicarage Hill, South Benfleet, Essex SS7 1PA / UK, e-mail: Geoffcads@aol.com]
--- No. 85 (May 2021): Melvyn Barnes: Freeman Wills Crofts. The Full Story / Philip L. Scowcroft: Dorothy L. Sayer’s Debut. Whose Body? / Michael Wilson: Crime Fiction and
the Grand-Guignol. Natural Bedfellows? / Philip Gooden: Anthony Burgess’s Spy Novel / Philip L. Scowcroft: Wild Animals and Snakes in Crime Fiction / John Goddard: Cooking Seton’s Goose (or Ten Little Murderers?)
/ Hannah Patient: Elly Griffiths and Archaeological Crime Fiction. Part 2:- Gender / Lyn McConchie: Charlie Harris and Diesel. The Cat in the Stacks Mysteries / Kate Jackson: What Did Golden Age Detective Fiction Ever Do for
Us? A Legacy … / Philip L. Scowcroft: More on Crime Fiction from the 1930s. Anthony Weymouth – E.R. Punshon – Anthony Wynne – Anthony Armstrong – Cecil St. John Sprigg / Martin Edwards: Hunting
„The Cornish Fox“ / Liz Gilbey: The Smarter Older Brother, aka The British Government. Mycroft Holmes / Peter Johnson: Great Openings to Classic Crime Stories / Mike Ripley: Bargain Hunt (38). Ronald Johnston „Red
Sky in the Morning“ / Jon Wilkins: Murder Through Her Eyes. How Maisie Dobbs Reflects Truth and Lies in 1930s Society. The Maisie Dobbs Novels of Jacqueline Winspear.
(vt) KTS 71
|
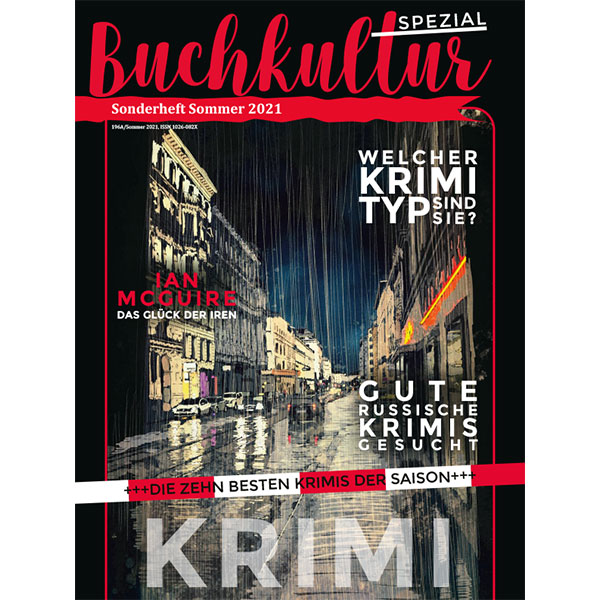
Schnepf, Michael / Jensen, Nils (Hg):
Buchkultur Spezial [Krimi].
2021, 32 S., Buchkultur Verlagsges.m.b.H. (Sonderheft Sommer 2021), ISSN 1026-082X,
Preis nicht mitgeteilt
Von Krimi-Fans (nicht nur aus Österreich) erwartet, liegt seit Mitte des Jahres die jährliche Spezial-Ausgabe des österreichischen Literaturmagazins „Buchkultur“
zum Krimi vor. Als Einleitung wie immer „Die zehn besten Krimis der Saison“, ausgewählt von einer (internationalen) Jury von Krimi-Buchhändlern, Krimi-Archiv, Krimi-Kritiker und einem Mitglied der Redaktion.
Die Aufstellung der „zehn besten Krimis der Saison“ werden durch ausführliche Rezensionen begleitet. Selbstverständlich wie in jedem Jahr finden sich in dem Krimi-Sonderheft zahlreiche thematisch gegliederte
Rezensionen und Kritiken („Rächen ist menschlich“, „Gut russische Krimis gesucht“ oder „Junior – Bitte Nerven kitzeln!“). Krimi-Kritiker Thomas Wörtche ist mit seinen Beiträgen
„Quick’n’Dirty – Achtsam lesen!“ und seiner Spurensuche „Gute russische Krimis gesucht“ vertreten. Sabine Treudl porträtiert den Iren Ian McGuire und seine Romane und Andrea Wedan
hat drei Kinder-Krimis für ihren Beitrag „Bitte Nerven kitzeln!“ gelesen. Ein interaktiver Krimi in sechs kurzen Absätzen, erstellt von Johannes Kössler mit jeweils 4 zu beantwortenden Fragen, gibt
nach Auflösung letztlich die Antwort „Welcher Krimityp sind Sie?“. Die Krimi-Fans müssen nach Lektüre wieder ein Jahr auf die nächste Krimi-Spezial-Ausgabe von „Buchkultur“ warten
– Hinweise auf genügend zeitverkürzenden Lesestoff bietet ja die aktuelle Ausgabe.
www.buchkultur.net
(tp) KTS 71
|

Wolf, Klaus-Peter / Bloem, Holger (Hg & Red.):
Ostfrieslandkrimis.
Klaus-Peter Wolf Zeitung. o.J., SKN / Ostfriesland Magazin, kostenlos
Zu jedem neuen Krimi von Klaus-Peter Wolf erscheint als Beilage in Tageszeitungen in Norddeutschland ein Extrablatt, „Ostfrieslandkrimis“ genannt, das den jeweils neuen
Kriminalroman in Artikeln und Interviews vorstellt. Zudem bringen kurze wie längere Beiträge aktuelle Informationen rund um den Klaus-Peter Wolf-Kosmos. Einige Ausgaben des PR-Magazin „Ostfrieslandkrimis“
stehen zum Download auf der Homepage von Klaus-Peter Wolf bereit:
https://www.klauspeterwolf.de/ostfrieslandkrimis-klaus-peter-wolf-zeitung/
(tp) KTS 71
|
Miscellanea
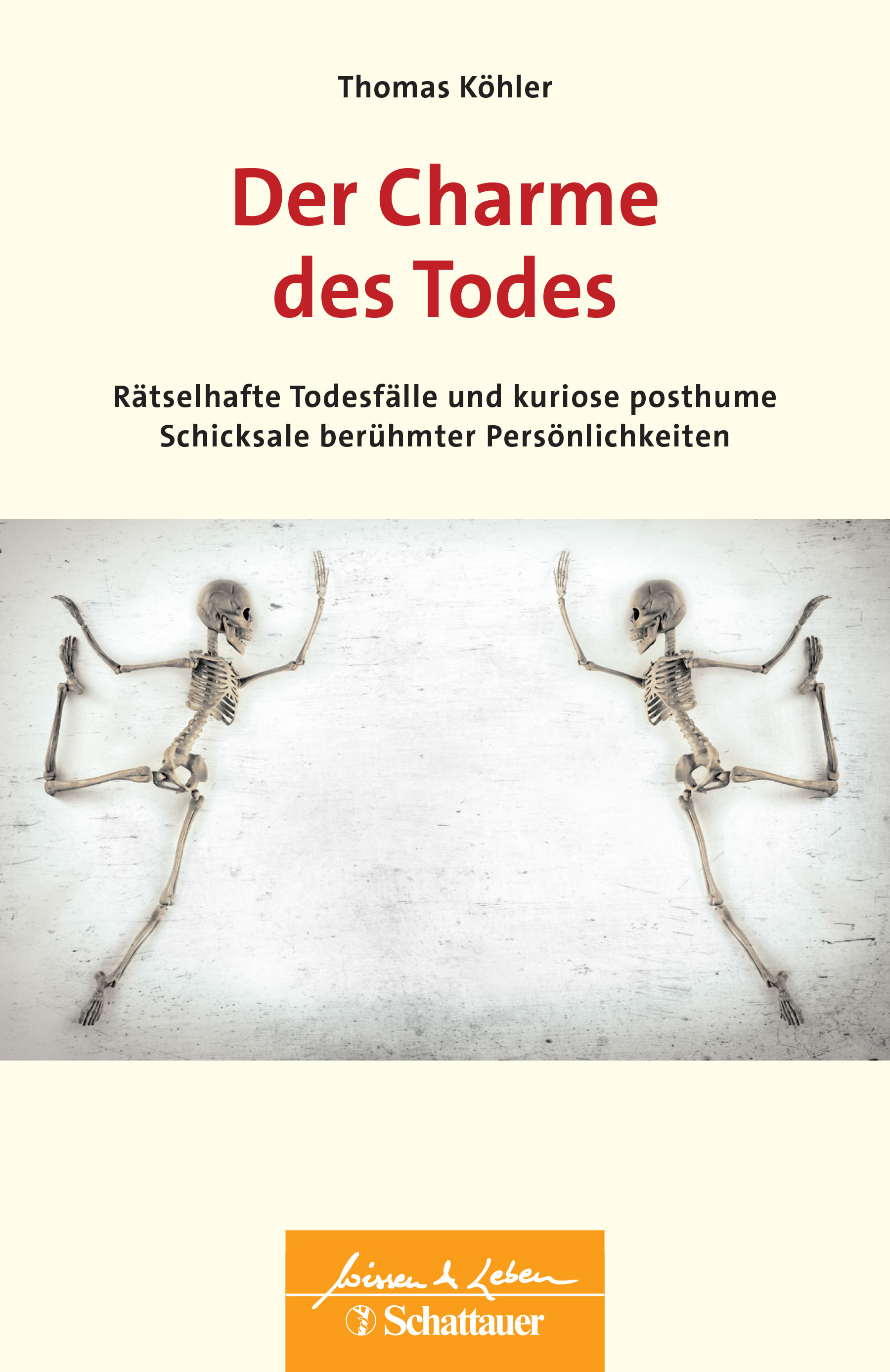
Köhler, Thomas:
Der Charme des Todes.
Rätselhafte Todesfälle und kuriose posthume Schicksale berühmter Persönlichkeiten.
2021, 166 S., 18 s/w Abbildungen und Fotos, Schattauer Verlag / Klett-Cotta (Wissen & Leben), 3-608-40054-0 / 978-3-608-40054-0, EURO 18,00
Was nach dem Tod kommt, wissen wir nicht? Wie gut, dass die berühmten Verstorbenen aus diesem Buch nicht mitbekommen haben, was nach ihrem Ableben mit ihnen passiert ist!
Ötzi hätte sich seinerzeit bestimmt nie träumen lassen, als berühmte Mumie durch zahlreiche forschende Hände zu wandern und durch die Medien des 20. und 21. Jahrhunderts zu tingeln. Schiller hatte
vermutlich auch anderes im Sinn als ein Verwirrspiel um seinen Schädel. Und Philipp dem Schönen wäre sicher Friedhofsruhe lieber gewesen als von Johanna der Wahnsinnigen quer durch Spanien gezerrt zu werden
– als Leiche! Und Kennedy, was hätte er gesagt, wenn er gewusst hätte, dass sein Tod vermutlich immer ein Rätsel bleiben würde? Thomas Köhler interessieren Todesfälle, bei denen etwas ganz
anders, schief oder charmant lief: von nicht verwesenden Leichen über gewaltsame Tode berühmter Persönlichkeiten – die Ermordung Cäsars, von Elisabeth von Österreich (Sisi), die Übertötung
Rasputins, die Erschießung der letzten Zarenfamilie u.v.m. – bis hin zu „faszinierenden“ Selbstmorden und postmortalen Unruhe-Schicksalen. Der Charme des Todes weht durch die Zeilen dieses Buches!
Inhalt:
--- 1. Zur Psychologie des Todes und der postmortalen Zersetzungsvorgänge.
Der Akt des Sterbens / Die natürlichen postmortalen Zersetzungsvorgänge (Verwesung, Dekomposition) / Die beabsichtige oder unbeabsichtigte Verhinderung der Verwesung
(„Mumifizierung“, „Mumifikation“): Vorbemerkungen / Die Mumifizierung bei den Ägyptern / Die Kirchen- oder Gruftmumien / Moorleichen / Wachsleichen / Moderne Methoden zur Erhaltung der Körperstruktur:
Konservierung in Alkohol, Formalininjektion und Plastination.
--- 2. Ungewöhnliche Todesfälle berühmter Persönlichkeiten.
Vorbemerkungen / Attentate: Vorbemerkungen und Beispiele / Das Attentat von Sarajewo / Ein sinnloses Attentat - Der Mord an der österreichischen Kaiserin Elisabeth / Das Attentat
von Dallas / Berühmte Morde: Vorbemerkungen / Wallensteins Tod / Die sieben Leben des Gregorij Jefimowitsch Rasputin.
Suizide, Doppelsuizide, erweiterte und kollektive Selbstmorde:
Suizide / Doppelsuizide / Erweiterte Suizide / Kollektive Selbstmorde: Die Eroberung von Masada / Rätselhafte und nur scheinbar rätselhafte Todesfälle: Der Fluch
des Pharao / Der Tod von Papst Johannes Paul I. / Die Mär vom Mord am Märchenkönig – Das Ende Ludwigs II. im Starnberger See / Tod durch Schlaf – Michael Jackson / Kuriose Sterbevarianten: Der Tod
von Arnold Schönberg / „Schicksalshafte“ Todesfälle: Die Folgen der Inzucht und die Bluterkrankheit im europäischen Hochadel.
--- 3. Ungewöhnliche posthume Schicksale.
Vorbemerkungen / Posthume Justiz: Die Leichensynode / Die Hinrichtung eines lebenden Königs und eines toten Lord Protector / Ein Leichnam reist durch Spanien / Schillers Schädel
/ Von Sarajewo nach Artstetten – Das unwürdige Begräbnis des österreichischen Thronfolgerehepaars / Die Gebeine der Romanows / Nicht verwesende Leichname – Ein ruchloser Ritter und drei Heilige /
Lenin im Schneewittchensarg.
--- Literatur / Personen- und Sachverzeichnis.
Prof. Dr. med. Dr. phil. Dipl.-Psych. Dipl.-Math. Thomas Köhler, Privatdozent am Psychologischen Institut der Universität Hamburg. Dozent
an verschiedenen Ausbildungsinstituten für Psychotherapeuten; Verfasser zahlreicher Monographien, u.a. zu Psychopharmakologie, Rauschdrogen, Biopsychologie und biologischen Grundlagen psychischer Störungen. Autor
u.a. von „Ruhm und Wahnsinn“ bei Schattauer (Wissen & Leben). (vt) KTS 71
|
Investigations From
„The Citadel – The Military College of South Carolina“
Dr. Katya Skow On Crime Fiction
--- entfällt
|
|
Jim Madison Davis
on
„Law and Order“
Expanding the World of the Private Eye:
Walter Mosley Becomes a Grand Master
[This article appeared originally in World Literatur Today]
Mexican crime novelist Paco Ignacio Taibo II frequently says that the North American crime novel
is unthinkable in the context of Mexico, and his words are a reminder of how crime fiction, like all good fiction, is rooted in the cultural assumptions of a particular people and time.
Mystery writing arose out of Enlightenment rationalization and the principle of empirical observation (the scientific sensibility) contrasted against the Gothic and Romantic faith
in the reliability of sensation. Science, in these stories, was contrasted with intense feeling and conquered it with rational explanations. This could only happen in a culture engaged with these opposing theses, as we still
are. Along with this metaphysical conflict at the core of the mystery, many patriarchal and ethnocentric values were attached to the genre, as they were with other forms of entertainment. The great detective of early mysteries
was often an odd person and occupied a place somewhere along a spectrum from passionate to passionless, but he imposed powerful skills of logic and observation to defend society against those who would undermine it. In the
context of the time, for one example, the prejudice prevailed that women were not by nature as rational as men. Novels that resorted to women’s intuition or “playing a hunch” were regarded as cheating on
the basic premises, ignoring the confirmable order of reality, never mind that the “logic” in many mysteries is ludicrous. Poe’s Chevalier Dupin, Doyle’s Sherlock Holmes, and Leroux’s Joseph Rouletabille
are the whitest of white men, and demonstrated along with many other fictional detectives a set of values which protect Western civilization against the evil schemes of the “yellow peril” and an assortment of swarthy
villains.
Should we be shocked by the racial prejudice we see in Poe’s “The Gold Bug”?
For us, it ruins a good kids’ adventure about lost treasure, but in that time? Though we now know such stereotyping generates a wrongheaded pattern of thinking that justifies discrimination and even violence, by their
standards it was goodnatured comedy. If African-americans appeared in mysteries, they were similar to the servant Jupiter in Poe’s story, usually decorative. That is to say they were not there as simulations of real
people. They were there for setting, novelty, or Stepin Fetchit style comic relief. If the butler was a black man, he didn’t do the crime. He wouldn’t have any more logical motivation than the furniture in the
conservatory. He may have witnessed something minor to report it, but as to having a relationship in the story to the other characters or the crime, not really. In 1918, the Ebony Company produced a one-reeler called A Black Sherlock Holmes, a broad parody for African-american audiences with characters named Rheuma Tism, I. Wanta Sneeze and Cheza Sneeze. As to the realistic portrayal
of African-american family, or community, there was little of that even in “race films,” movies made specifically for black audiences. The same complaint can be made about the other “outsider” identities
in such movies and stories—inscrutable Asians and deceptive Arabs, or even Cockney gardeners. Exotic detectives had a vogue—Charlie Chan, Mr. Moto—but blacks were evidently not exotic enough to participate
in this and were generally ignored. I once had the misfortune of being on a conference panel discussing “political correctness” and vividly remember a writer declaiming that she saw no reason to put Pakistanis
and Vietnamese in books simply to be politically correct. To which I said, “No, you put them in the book because they are here. Leaving them out is lying.”
This is the importance of Walter Mosley, who was recently announced as the Mystery Writers of
America newest Grand Master. It is only recently that African-americans consistently became more than one-dimensional characters in crime novels, and Mosley’s writing is often credited with changing this. Though he was
preceded by any number of African-american writers, they had a more limited impact. I suspect that the pulp era had a number of pseudonymous black authors tapping out a living at five cents a word, just as it had a number
of women passing for hard-boiled male writers. The great Chester Himes began writing in the late 1930s after a term in the penitentiary. His first novel appeared in 1945, but in general, his work flew under the radar in the
United States. It was first acclaimed in France where he immigrated in the 1950s and achieved international success. In 1957, he wrote his first detective novel, beginning his Coffin Ed and Gravedigger Jones series, which
managed to take advantage of the rise of pulp literature directed toward African-americans in the 1960s. The white-owned publishing company, Holloway House, published authors like Donald Goines (acclaimed on covers as “The
Greatest Ghetto Writer That Ever Lived!”), Roland Jefferson, Robert Beck, and Joe Nazel, who could knock out a novel in six weeks. Yet, rather like the blaxploitation films of that era, novels like these usually remained
in the niche market. Finally, in 1988, Gar Anthony Haywood, one of the finest contemporary detective writers, managed with Fear of the Dark to poke a hole in the wall of the black detective’s “ghetto,” perhaps setting up a climate that helped Walter Mosley’s Devil in a Blue Dress become a bestseller and a modern classic.
As Mosley recounted it to the Daily Press (Newport News, Va.), he was 34 years old and bored with computer work at his job with Mobil Oil in Manhattan. No one else was around, so he wrote a sentence,
“On hot sticky days in Southern Louisiana, the fire ants swarmed.” He had the thought “this could be a novel.” His storytelling impulse wouldn’t slow down once it was released. He writes every
day, explaining that it is what he most enjoys in life. He has now authored some four dozen books. Mosley was born in Los Angeles, but his father was one of the many Louisiana blacks who sought opportunity by migrating. “These
people,” he told the New York Times, “created an orally transmitted literary life out of a soil drenched by the blood of slaves and ex-slaves,
Creoles, Cajuns, and the French.” In interviews he speaks of how the people who come from such a history can tell family stories of setbacks and suffering with a smile on their lips. Easy Rawlins, the Louisiana-born
detective he created for Devil in a Blue Dress, is now one of the best-known fictional detectives in America, but Mosley does not limit himself to the Rawlins
series. He has written a series featuring Leonid McGill ( a contemporary private eye), another featuring Socrates Fortlow (an ex-con), and yet another featuring Fearless Jones. As inventive and improvisational as Miles Davis,
he has also penned many “one-off” literary and science fiction novels, short stories, plays, screen plays, and non-fiction.
Devil in a Blue Dress is clearly based on the hard-boiled tradition: the tough detective in search of truth, the femme fatale, the mean streets, the cops who can’t
be trusted. For fans of the pattern, this all has a comfortable familiarity that allows Mosley to bring in a further reality, confronting readers with the enormities of racism. The traditional crime novel is inconceivable
in many black communities. Bad cops are not simply corrupt bullies, as they are in, say, Raymond Chandler’s or Dashiell Hammett’s novels. They are bullies because of what they perceive as their racial superiority.
When private eye Philip Marlowe in Farewell, My Lovely goes into a part of the city transitioning into a black neighborhood, we get a shockingly realistic
glimpse of the relationship between the cops and the residents. But only a glimpse. It isn’t central to the story. The racial aspect of the chapter has usually been written out of the film versions as unpalatable for
white audiences. The implicit social commentary that is so much a part of the hard-boiled novel, however, allows Mosley to use the same framework to communicate racial realities. One people’s justice is another’s
barbarity. Perhaps by 1990 a large readership was ready for a more direct confrontation with the racial dynamics that corrupt so much of what happens in America. President Bill Clinton said Mosley was one
of his favorite writers. The hardboiled detective novel, along with the police procedural, has always promised a more direct expression of the harsher realities, and though the preponderance of pulp jockeys merely exploited
the sordid for shock value, a masterly writer like Mosley can adapt the tradition to his own significant purposes.
Since 1955, when the Grand Master award was first given to Agatha Christie, no African-american has received it. Naturally much
of the focus on Mosley will emphasize this, especially in a year when racial diversity is a controversy at the Oscars. Few people will be paying much attention to the fact that Mosley’s mother, born Ella Slatkin, was
of eastern European descent, and Mosley embraces his Jewish heritage as completely as he embraces his African-american heritage. His cousin taught him Yiddish curses. He learned to enjoy what he describes as the Jewish give
and take of debating ideas from opposing points of view. He compares the experience of the Jews with that of African-americans and has provoked some anger by calling the Jews a non-white race, the “Negroes of Europe.”
Yes, he says, Judaism is a religion, but most Jews are not particularly religious. After reading The Color Purple, Mosley was impressed and took courses to develop his writing. One of his instructors, Edna O’Brien, told him, “Walter, you’re black, Jewish, with a poor upbringing. There are riches
therein.” His books feature black hero protagonists because he feels they are highly underrepresented, but his Jewish background informs his portrayal of the black community and perhaps makes him even more insightful
about it. Categorizing writers is something we often do, but it often is a fool’s exercise. What we really value in a writer is the uniqueness. Walter Mosley is Walter Mosley is Walter Mosley, and there are riches therein.
© Jim Madison Davis
|
Unter der Lupe
|
Martin Compart
Unter der Lupe
Thriller
Als John Mairs Roman Never Come Back erschien, stand der britische Spionageroman schon in erster Blüte. Ausgehend von den Invasion-Romanen eines William Le Queux, Rudyard Kiplings «Great Game»-Roman Kim und Erskine Childers Riddle of the Sands entwickelte sich im und nach dem Ersten Weltkrieg ein Genre mit breitem Spektrum.
Den prägendsten Einfluss übte der Schotte John Buchan aus, der mit dem Klassiker The 39 Steps (seit 1915 in Britannien ununterbrochen lieferbar) eine Art Blaupause für viele Thriller lieferte (die auch in Never Come Back nachschwingt: Ein Zivilist wird in eine Verschwörung verwickelt, muss vor Sicherheitskräften und Konspirateuren fliehen und während dieser atemberaubenden
Jagd die Konspiration aufklären und verhindern).
In den 1920er Jahren entstanden neben diesen politisch konservativen Thrillern auch faschistoide, wenn nicht faschistische Thriller. Zum Synonym für diese brutale Spielart des
Politthrillers wurde «Sapper» mit seiner Bulldog Drummond-Serie, die vor Antisemitismus und Rassismus nur so strotzt. In diesen Spionagethrillern tobte
die Paranoia des britischen Empires. Es fühlte sich von allen Seiten bedroht, von anderen Mächten und politischen Systemen. In Britannien verschärfte sich der Klassenkampf und in den Kolonien kam es zu Aufständen.
Dahinter – so suggerierten nicht nur Sapper & Co. – standen Kommunisten, unterstützt von der Sowjetunion, Anarchisten, eifersüchtige Imperialmächte wie Frankreich oder die USA oder
das Finanzjudentum.
Bulldog Drummond und Richard Hannay hatten alle Hände voll zu tun, feindliche Sabotage- und Spionageringe aufzuspüren und unschädlich zu machen. Die Populärkultur
feierte nach wie vor Britanniens imperiale Allüren.
Beginnend mit Somerset Maughams Kurzgeschichtenzyklus Ashenden (1928) begann eine Tendenz zu bis dahin nicht gekanntem Realismus im britischen Spionageroman. Autoren wie Eric Ambler oder Graham Greene verfestigten diese literarische Strategie. Danach unterscheidet man zwei
Schulen des Spy Thrillers: die romantische und die realistische (mit vielen Überschneidungen im Laufe der Jahrzehnte).
1939, in dem Jahr, als Mair seinen Roman angeblich begann, erschienen drei Meilensteine des Genres, die er wahrscheinlich gelesen hatte: The Mask of Dimitrios von Eric Ambler, The Confidential Agent von Graham Greene und Rogue Male von Geoffrey Household. Mit Eric Ambler verbindet Mair auch die linksliberale politische Orientierung.1
Aber vielleicht hatte Mair auch später Graham Greene beeinflusst: Man weiß nicht, ob Graham Greene Mairs Roman gelesen hat. Aber in Ministry of Fear (1943) weist einiges darauf hin, besonders die atmosphärischen Beschreibungen Englands während des Krieges (und Greene schrieb den Roman bekanntlich während
seiner Zeit in Sierra Leone als Mitarbeiter des Geheimdienstes). In beiden Romanen finden die Aktionen in «Echtzeit» statt, genau in diesem Moment, nach dem sogenannten «Phoney War» oder «Sitzkrieg»,
in dem die Deutschen soeben die Kapitulation Frankreichs erzwungen und begonnen hatten, die Inseln zu bombardieren. Allerdings spürten die britischen Bürger die Auswirkungen des Konflikts noch nicht so intensiv wie
ab September 1940 (The Blitz), als die deutsche Luftwaffe auch die Städte angriff. Man schien sich durch die Insellage noch sicher zu fühlen und war eher
optimistisch. Was würde als Nächstes passieren? Niemand wusste es so recht und die meisten waren nicht allzu beunruhigt.
Mair kannte das Genre und hatte sich bewusst für die Form des Thrillers als Romandebüt entschieden. Julian Symons berichtet, dass Mair häufig Thriller rezensiert hatte,
darunter eine Symons beeindruckende Besprechung von James Hadley Chases Roman No Orchids for Miss Blandish, der ebenfalls 1939 erschienen war. In dieser Rezension, die Symons in Bloody Murder zitiert, führte Mair akribisch alle Straftaten auf, die in Chases Roman begangen werden.2
Ich vermute, dass auch G. K. Chestertons «philosophischer Thriller» The Man Who Was Thursday einen gewissen Einfluss auf Mairs Roman hatte: Das dort beschriebene Anarchisten-Zentralkomitee ist ebenso surreal wie Mairs Oppositions-Internationale.
Der Antiheld
Mit seinem Antihelden bricht der Roman durch eine literarische Straßensperre nach der anderen. Nie zuvor wurde mit den etablierten Klischees des Spionageromans konsequenter gebrochen.
In Never Come Back gibt es weder einen Clubland-Hero noch eine patriotische Mission – und nicht mal eine «damsel in distress».
Symons stellt fest, dass Desmond Thane ganz bewusst als Gegenentwurf zu den angstfreien Helden von John Buchan oder Sapper konzipiert worden war (und dass Mair einige Merkmale seiner
eigenen egozentrischen Persönlichkeit hat einfließen lassen).
Der Protagonist Desmond Thane ist eine überraschend dreidimensionale Figur, wie es sie damals im Thriller kaum gab. Er gehört wahrlich nicht zu den «Clubland Heroes»
à la Richard Hannay, Jonah Mansel oder Bulldog Drummond, die mit ihrem Patriotismus den britischen Spy Thriller dominierten.3
Thane ist – wie Julian Symons bemerkt – der erste Antiheld des Genres.
Er ist ein pathologischer Lügner, beherrscht von eigenem Vorteilsstreben. Er ist eitel, sexbesessen, feige und egozentrisch. Nichts interessiert ihn weniger als kosmische Harmonie,
denn er behauptet sich in der scheinbaren Sicherheit von Spekulationen.
Es zeigt John Mairs Fähigkeiten als Schriftsteller, dass er für ihn trotzdem Empathie beim Leser erzeugt. Denn Thane ist auch clever und schlagfertig wie ein amerikanischer
Private Eye, der jedes Dilemma, in das er gerät, annimmt und sich herauszuwinden versteht. Ob wir wollen oder nicht: Seine derbe, überschäumende Vitalität und Cleverness nötigen uns Respekt ab.
In gewisser Hinsicht greift er mit seinem sexuellen Appetit auf spätere Thriller-Helden wie James Bond voraus. Mit Bond verbindet ihn auch seine Neigung zum Hedonismus. Dabei
unterscheidet er sich aber doch sehr von Bond durch seinen Egoismus, dem patriotische Motive fremd sind. Als echter Antiheld interessiert ihn keinesfalls das Wohl des Vaterlandes. Ihm geht es nur um den eigenen Vorteil: Nachdem
er herausgefunden hat, was seine Gegenspieler wollen, denkt er daran, es ihnen teuer zu verkaufen und mit dem Erlös ein Leben in Wohlstand zu führen. Dafür allein hätte Bond ihn erschossen.
Und seine physischen Fähigkeiten scheuen ebenfalls jeden Vergleich mit 007.
Anders als die Amateure in den frühen Ambler-Romanen, die zufällig in eine Konspiration geraten, treibt Thane sich selbst durch sein sexuelles Verlangen in die düstere
Welt von Anna Raven. Für ihn sind Verbrechen nicht Ursachen für, sondern Konsequenzen von Entwicklungen.
Thane sieht sich als erfolgreicher Frauenheld, beladen mit einem antiquierten Frauenbild. Das wird ihm zum Verhängnis, als er Raven trifft und Besitzansprüche stellt.
Sie aber ist eine selbstbewusste moderne Frau, ebenfalls ziemlich ungewöhnlich für die Thriller der damaligen Zeit. Sie bestimmt über ihre Sexualität – sehr zu Thanes Missfallen.
Verärgert muss er feststellen, dass sie ihn dominiert und so behandelt, wie Männer Frauen «gewöhnlich» behandeln. Für sie ist der Sex mit ihm ein rein episodisches Vergnügen ohne emotionale Einlassung. Sie
unterwirft sich nicht seiner göttlichen Männlichkeit. Thane kann damit nicht umgehen, wird immer verunsicherter (eine Situation, die auch heute noch bei Männern zu Komplikationen oder Gewaltausbrüchen führt).
Ungewöhnlich für das Genre sind auch Thanes Neigungen zum Philosophieren:
«Selig der Mensch, so dachte er, ohne geistige oder körperliche Leidenschaften, der mit gleichem Abscheu an Buchhandlungen, Bordellen und Reisebüros vorbeizugehen
vermochte. Eigentlich schade, dass man sich heutzutage nicht mehr dem Teufel verschreiben konnte; der allgemeine Niedergang des Glaubens hatte diesen Markt ruiniert und den Verderbten lediglich die Rolle des verachteten Proletariats
zugewiesen; zu verkaufen blieb denen nichts als ihre ohnehin verlorenen Seelen. Faust hatte Juristerei, Medizin, Logik und Philosophie immerhin noch gegen vierundzwanzig Jahre voller Macht und Herrlichkeit eingetauscht; inzwischen
steckten alle Hauptstädte randvoll mit Gelehrten, die diese vier Disziplinen und allerlei weiteres Wissen liebend gern für ein paar Schillinge und gelegentliche Vortragsreisen hingegeben hätten. Laster unterlagen
einer Überproduktion, wie anderes auch.»
Mairs Prosa ist stets raffiniert. Und wann haben wir je von einem Bösewicht gelesen, der die Konsequenzen seiner Missetaten im Lichte philosophischer Lehren analysiert?
Man muss Julian Symons wohl zustimmen, dass Mair in Thane auch ein Selbstporträt anlegte, eine Innenschau des damals achtundzwanzigjährigen Autors. Kein besonders schmeichelhaftes
Selbstbild, aber vielleicht treffend angesichts der ihm nachgesagten Egozentrik. Jedenfalls ist Thane ein runder Charakter, wie er in der damaligen Thriller-Literatur selten oder eher gar nicht präsent war. Ein Typ, an
dem Patricia Highsmith sicherlich Vergnügen gefunden hätte.
© Martin Compart
„Thriller“ und „Der Antiheld“ ist ein Auszug aus dem Nachwort von Martin Compart zu „John Mair: Es gibt keine Wiederkehr. Ein Klassiker des Polit-Thrillers“.
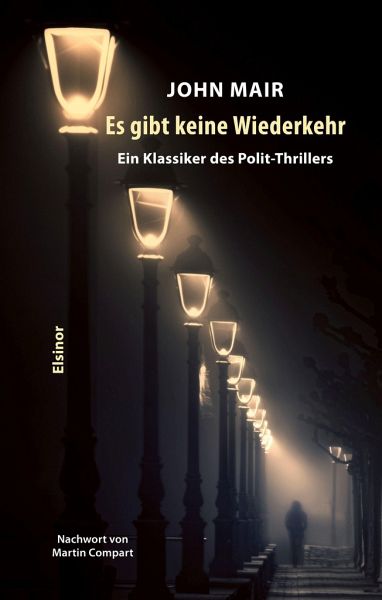
Mair, John: Es gibt keine Wiederkehr. Ein Klassiker des Polit-Thrillers. [Herausgegeben von Martin Compart]. 2021, 264 S., 4 s/w Abbildungen,
(im Anhang: „Der vergessene Klassiker“, Nachwort von Martin Compart / Auswahlbibliographie zum Spionageroman), (Never Come Back, Ü. a.d. Englischen v. Jakob Vandenberg), DEA, Elsinor Verlag, 3-942788-56-X
/ 978-3-942788-56-4, EURO 18,00
Im Affekt und halb aus Versehen tötet der britische Boulevardjournalist Desmond Thane seine Geliebte – ohne freilich zu ahnen, dass sie für eine internationale
Geheimorganisation tätig war. Deren Agenten und Profikiller sehen ihre politische Verschwörung in Gefahr. Also müssen sie Thane aus dem Weg schaffen, um jeden Preis und auf ihre Weise.
John Mair, Sohn eines prominenten Journalisten und einer Schauspielerin, wurde 1913 in London geboren. Er
brillierte als Debattenredner, publizierte eine vielbeachtete Studie über ein Pseudo-Shakespeare-Drama und schrieb Essays und Literaturkritiken für renommierte Zeitungen. 1939 begann er mit der Arbeit an seinem Thriller
„Never Come Back“ („Es gibt keine Wiederkehr“), der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Nach der Einberufung zur Luftwaffe entschied sich Mair für eine Pilotenausbildung; bei einem
Trainingsflug kam er im April 1942 beim Zusammenstoß zweier Flugzeuge ums Leben.
|
|
8 Fragen an Martin Compart
Kurzbio: Geboren 1954 in Witten. Studium der Politologie. Damals auch Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft
Kriminalliteratur. Herausgeber der gelben Krimi-Reihe, Populäre Kultur und Ullstein-Abenteuer; Herausgeber der Schwarzen Serie, Thriller, Polit-Thriller bei Bastei-Lübbe; Herausgeber Dumont Noir und Teilhaber beim
Strange Verlag. Artikel für zahlreiche Zeitschriften, daneben Radio-Features und TV-Produktionen. Zehn Jahre Mitglied in der Grimme-Jury. Teilhaber des Zerberus Verlages und Betreiber mehrerer Blogs.
Homepage: www.martincompart.wordpress.com
Thomas Przybilka: Was bedeutet Kriminalliteratur für Sie und ist, Ihrer Meinung nach, Kriminalliteratur eine wichtige Literaturgattung?
Martin Compart: Kriminalliteratur in ihren vielen Facetten ist m.E. eine der wichtigsten zeitgenössischen Gattungen. Ihr Grundthema ist die Problematik des Menschen sich in Gesellschaften großer Dichte zu
organisieren und die Reaktion durch abweichendes Verhalten auf Ungerechtigkeitsordnungen. Darüber hinaus funktioniert sie auch als ästhetischer und soziologischer Seismograf.
Das Genre ist reich an Facetten, so genannte Subgenres vom Polit-Thriller bis zum Psychokrimi, die alle Aspekte des menschlichen Lebens abbilden können.
Allerdings gilt wohl auch für die Kriminalliteratur, was Theodore Sturgeon über die Science Fiction gesagt hat: „95% der Science Fiction ist Schrott, aber
95% von allem ist Schrott.“
Angesichts der imponierenden Geschichte des kriminialliterarischen Genres würde ich aber nicht so weit gehen. Eher 70%.
Ich persönlich bevorzuge Polit-Thriller und Noir-Romane, die im Gegensatz zur Ordnung bestätigenden Kriminalliteratur eine Welt zeigen, in der die Personen nicht
mehr die Kontrolle über die Gesellschaft haben, sondern bestenfalls darüber entscheiden, wie sie in ihr überleben.
TP: Ihr Weg zur Kriminalautorin / zum Kriminalautor?
MC: Fast klassisch: Enid Blyton & Co. als Kind, Kommissar X
und Jerry Cotton und dann die Entdeckung einer Bücherkiste
voller Ullstein-Krimis unter dem Bett meiner Mutter.
Damals hatten Taschenbücher ganz allgemein keinen Platz in
der Bibliothek.
Nachdem ich mehrere Jahrzehnte theoretisch über
Kriminalromane gearbeitet hatte und als Kritiker und
Herausgeber tätig gewesen war, wollte ich wissen, ob ich
selbst einen Thriller schreiben kann, ob ich tatsächlich
die lange Distanz eines Romans schaffe. Erfahrungen mit
Drehbüchern hatte ich bereits – aber das ist ja was ganz
anderes.
TP: Ihre erste Krimi-Veröffentlichung?
MC: Ich wollte ursprünglich ein Sachbuch über Dutroux
schreiben, fand aber keinen Verlag, der mir die Recherche
mitfanzieren wollte. Damals spielten die Medien großteils
die politischen Implikationen und die Dimensionen des
organisierten Kindesmissbrauchs herunter; heute fliegt
ihnen das alles um die Ohren und der Fall Dutroux, der nur
ein Handlanger war, harrt nach wie vor der lückenlosen
Aufklärung (über 30 tote Zeugen inzwischen). Ich dachte,
dass ich meine Recherchen zur Grundlage eines Thrillers
machen könnte – und so entstand DER SODOM KONTRAKT.
TP: Wurden Sie vom Werk einer Krimiautorin / eines
Krimiautoren beeinflusst?
MC: Natürlich von vielen, bewusst und unbewusst. Was den
Umgang mit Fakten und Tempo bei den Gill-Romanen angeht,
war Forsyth ein wichtiger Einfluss. Natürlich Manchette,
aber vor allem politisch; seine ästhetischen Konzepte
haben mein Schreiben eher nicht beeinflusst.
Aber auch andere Medien haben die Bücher beeinflusst.
LEMMINGE IM PALAST DER GIER sollte ursprünglich eine
Hommage an die Filme von Jean-Pierre Melville werden und
lief völlig aus dem Ruder. Eher ein Melville, der mit
einer Abrissbirne geschrieben wurde.
Und TV-Serien (natürlich DER MANN MIT DEM KOFFER)waren von
Einfluss und ich war m.E. einer der ersten, der einen
Soundtrack in die Thriller schrieb.
Was das Tempo angeht – ich hasse langsame Romane, wenn sie
das nicht stilistisch ausgleichen können – gehören zu
meinen Top-Favoriten Autoren wie Gavin Lyall, Campbell
Armstrong, John F.Case, James Hadley Chase, John Ralston
Saul, Simon Kernick, Alan Williams und die großen
Paperback Original-Schreiber. Auch von Duncan Kyle habe
ich einiges gelernt. Aber darüber habe ich reichlich
Artikel und Analysen in meine Blogs gestellt.
TP: Gibt es den „Frauenkrimi“ (im Sinne von feministischer
Kriminalliteratur)?
MC: Natürlich. Das ist ein völlig legitimes Sub-Genre, das
sich parallel zur gesellschaftlichen Entwicklung etabliert
hat und inzwischen auch höchst unterschiedliche Facetten
vorweist. Ich würde das angeblich neue Genre des domestic
noir nicht unbedingt der feministischen Strömung des
Frauenkrimis zurechnen, aber es vermittelt auf der Höhe
unseres westlichen gesellschaftlichen Zustandes die
fortschreitende Verdinglichung in Beziehungen und
Familien.
Die audiovisuellen Arbeiten von Jessica Biel haben da in
den letzten Jahren stärkere Akzente gesetzt als die
pseudo-progressiven weiblichen Ermittlerinnen in
reaktionär strukturierten Neo-klassischen Detektivromanen.
Diese Pseudo-Emanzen sind nicht mehr als ein Marketing-
Label.
TP: Gibt es einen Kriminalroman/Thriller, den Sie selber gerne
geschrieben hätten?
MC: Hunderte – falls das reicht. Aber ich sehe mich als Hobby-
Autor, schon gar nicht als Schriftsteller (obwohl ich
meine Romane im Rahmen meiner Möglichkeiten sehr wichtig
genommen habe und nehme).
Meinen wichtigeren – wenn ich so vermessen sein darf –
Beitrag zur Kriminalliteratur in Deutschland sehe ich im
sekundärliterarischen: als Mitbegründer eines Fandoms,
Sekundärliterat und Herausgeber.
TP: Welche Autorin / welcher Autor ist Ihrer Meinung nach
überschätzt (national und/oder international)?
MC: So ziemlich jeder deutsche Autor, der auf der deutschen
Bestsellerliste landet. Die sind fast alle zu dumm um
inkompetent zu sein. So eine Art kriminalliterarisches
Äquivalent zu Modern Talking. Aber das spricht ja weniger
für die Autoren als gegen ihre Käufer. Man sollte es mit
der Inklusion auch nicht überstrapazieren.
Der Niedergang des Bildungssystems spiegelt sich
dramatisch im Kaufverhalten deutscher (Krimi-)Leser.
Unfassbar, wie viele schlechte Bücher gegenwärtig
erfolgreich veröffentlicht werden.
Aber natürlich gibt es auch genügend internationale
Idioten, wie die Manufaktur James Patterson oder diese
Welle von reaktionären Agententhrillern, meist dick,
langweilig, primitiv-brutal und so blöde, als hätte sie
Donald Trump in einem Tweed geplottet.
TP: Welche Autorin / welcher Autor ist Ihrer Meinung nach
unterschätzt (national und/oder international)?
MC: Viele. Da müsste ich auch auf meine Artikel verweisen.
Aktuell möchte ich vielleicht Boston Teran herausheben.
Und falls es einen literarischen Gott der Gerechtigkeit
geben würde, müsste Mick Herron, der von Diogenes leider
sehr ungeschickt präsentiert wird, die deutschen
Bestsellerlisten anführen. R.J. Ellory und Kent Harrington
stehen bei mir auch weit oben auf der Liste unterschätzter
lebender Autoren. Ich sollte auch Joseph R. Garber
erwähnen, den viel zu früh verstorbenen Thriller-Meister
des Menschenjagd-Romans.
Kriminalromane / Thriller:
--- 2007, Der Sodom-Kontrakt
--- 2011, Die Lucifer-Connection
--- 2019, Lemming im Palast der Gier
--- 2019, Moneyshot
Sekundärliteratur zum Genre
--- 2000, Crime TV. Lexikon der Krimi-Serien
--- 2000, Noir 2000. Ein Reader
--- 2004, Dark Zone. Ein Noir-Reader
--- 2001, Das Sherlock Holmes-Buch. Zum 100sten Geburtstag des
Meisterdetektivs
--- 2010, G-Man Jerry Cotton. Eine Hommage an den
erfolgreichsten Krimihelden der Welt
--- 2010, 2000 Lightyears from Home. Stones, Fauser und andere
Verbrechen
Zusammen mit Thomas Wörtche
--- 1989, Jahrbuch der Kriminalliteratur
--- 1990, Das Krimi-Jahrbuch 1990
© Thomas Przybilka
Bonner Krimi Archiv Sekundärliteratur – BoKAS
|
"Zu guter Letzt"
(Gitta List / Bonn)
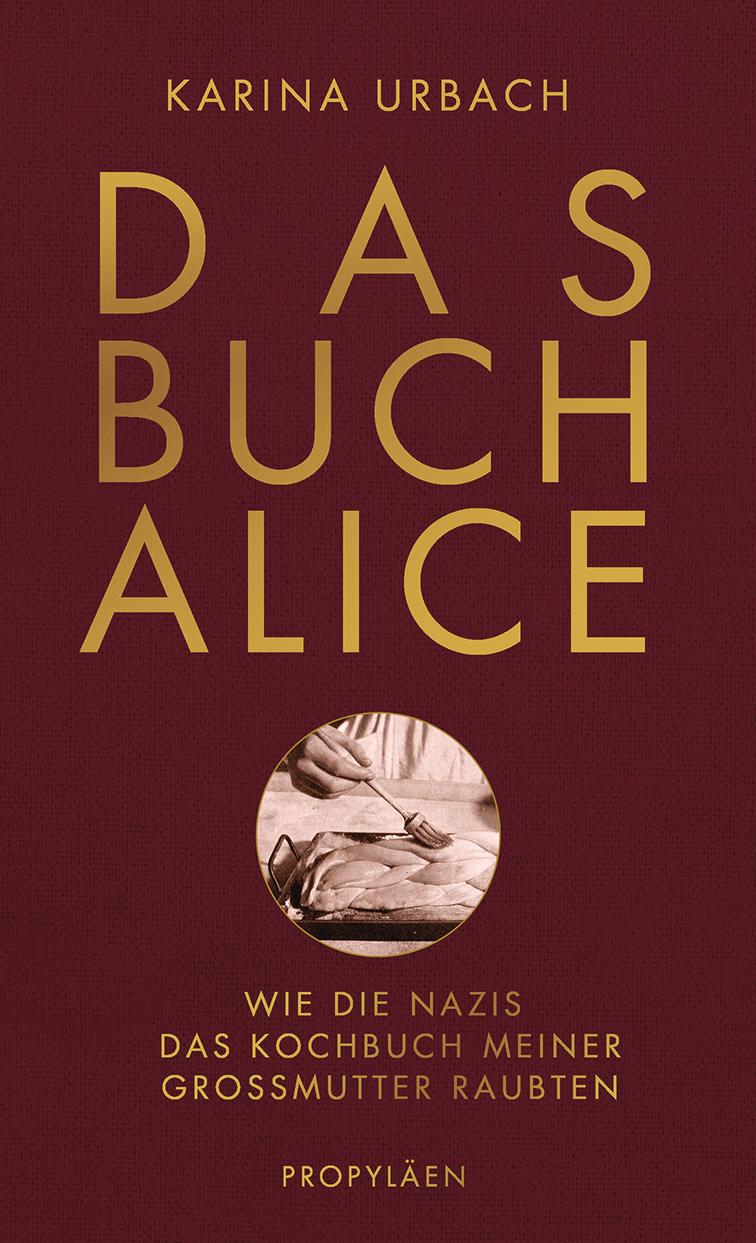
Bücherdiebe
»Es wäre ganz einfach: So kocht man in Wien! ist ein Buch von Alice Urbach.«
So lautet der letzte Satz im „Buch Alice“, verfasst von Karina Urbach, einer renommierten, international tätigen Historikerin (derzeit nimmt sie einen Forschungsauftrag in Princeton wahr) – und Enkelin von Alice, deren Leben und
Wirken sie in dieser brillant geschriebenen Biographie (und zugleich Familiengeschichte) auf der Basis von Briefen und Aufzeichnungen der Großmutter sowie zahlreichen intensiven Recherchen nachzeichnet. Sie trägt
den Untertitel „Wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten“, womit ein Fokus gesetzt ist, den die Autorin im Vorwort noch einmal präzisiert: „Dieses Buch ist im Laufe der Recherche auch
zu einer Diebstahlanzeige geworden.“ Urbach dokumentiert nicht allein die Vita ihrer (seinerzeit für ihre Kochkünste und eben auch für das von ihr verfasste Standardwerk zur Wiener Küche berühmten)
Großmutter, sie berichtet auch davon, wie ein deutscher Verlag bis heute nicht willens ist, (s)eine Mitwirkung an einem geistigen Diebstahl zuzugeben.
Alice Mayer war Tochter einer wohlhabenden (und vielköpfigen) jüdischen Wiener Familie, ihr Vater Sigmund, studierter Jurist, hatte es als Unternehmer ›zu etwas
gebracht‹, ökonomisch wie gesellschaftlich. Die Familie pflegte Kontakte zur Wiener „Künstler- und Geistesnobilität“ (zu den Familien Freud, Polgar, Schnitzler etwa) engagierte sich zudem in
Kultur und Politik. Kein sehr glückliches Gespür bewies er indes, als er für Tochter Alice einen Gatten auswählte, der zwar aus gutem Hause kam und als Arzt einen standesgemäßen Beruf hatte,
leider aber auch ein notorischer Spieler und Fremdgänger war.
Die Ehe war kurz, aber unglücklich, allein die beiden Söhne Otto und karl versöhnten Alice mit den wenig erfreulichen sieben Jahren an der Seite Max Urbachs. Nach
dessen Tod war sie zwar den ungeliebten Gatten quitt, hatte aber sogleich wieder andere Sorgen: Überlebenssorgen. Doch sie war nicht die Frau, sich unterkriegen zu lassen, und wenn sie auch nicht studiert hatte wie ihre
von ihr so bewunderte Schwester Helene, so besaß sie doch ein besonderes Talent und wusste es zu nutzen: Alice Urbach war eine höchst begabte und kreative Köchin. Als die Hungerjahre nach Ende des Ersten Weltkriegs
vorüber waren und es um 1923/24 „endlich wieder viele Nahrungsmittel“ gab, wagte sie den Versuch, eine Kochschule zu eröffnen – und hatte damit (fast) sogleich Erfolg, mehr noch, sie wurde zu einer
anerkannten Institution: „Im Laufe der Jahre erlangte meine Kochschule eine solche Beliebtheit, dass es eine Art ›Muss‹ für junge Mädchen wurde, bei mir einen Kochkurs zu absolvieren. Ich hatte
alle möglichen Schüler, Schauspielerinnen, Adlige und sogar ein paar Männer“, heißt es in ihren Aufzeichnungen – das Jahr 1935 war geradezu ein Erfolgsjahr für sie, und es erschien, „beste
Neuigkeit des Herbsts“, im Verlag Ernst Reinhardt (München) ihr zweites Kochbuch So kocht man in Wien!. Es „war 500 Seiten dick und enthielt alles, was sie seit ihrem fünften Lebensjahr über Kochen und Haushaltsführung gelernt hatte“, schreibt Karina Urbach und resümiert
für diese Zeit: „Alles schien zu gelingen“.
So sollte es nicht bleiben. Im März 1938 zog Hitler „unter dem Geläut von Kirchenglocken“ und dem Jubel Tausender in Wien ein, der ›Anschluss ans Reich‹
war vollzogen, die österreichischen Nationalsozialisten triumphierten, „Hassorgien“ gegen politische Gegner und vor allem gegen die jüdische Bevölkerung begannen. Und es begann die „Arisierung“
ihrer Geschäfte, Wohnungen, Vermögen; wie in Deutschland raubte man auch in Österreich die Juden systematisch aus, bevor man sie vertrieb, inhaftierte, ihnen das Leben nahm. So war auch die Familie Urbach nicht
mehr sicher, es begann eine Zeit der Angst.
Otto, Alice’ ältester Sohn, der in den USA beruflich reüssiert ›sein Glück gemacht‹ hatte, setzte alle Beziehungen, die ihm dort zur Verfügung
standen, ein, um seiner Familie zu helfen. Es gelang nicht für alle. Seine Mutter und sein Bruder aber konnten überleben; Alice gelang die Ausreise nach England, im dortigen Exil wurde sie Leiterin eines Kinderheims.
Karina Urbach hat im Vorwort zum „Buch Alice“ angemerkt, Familienforschung gelte unter ihren Historikerkollegen eigentlich als „schwerer Straftatbestand“,
des „Mangels an emotionaler Distanz zu den beteiligten Personen“ wegen. Nun, Urbach ist es unbedingt gelungen, einerseits das Gebot, „Rührseligkeit zu vermeiden“, einzuhalten und gleichwohl auf
höchst eindrucksvolle, intensive Weise von ihrer Großmutter, ihrer Familie – zugleich auch von einer Zeit, einer Gesellschaft, der Stadt Wien in den 1920er, 30er, 40er Jahren zu erzählen*.
Alice Urbachs Kochbuch war, das erwies sich bereits mit seiner ersten Auflage, ein Bestseller. Es war ein Standardwerk, gewissenmaßen ein Koch-Duden – aber nach der
Umschaltung der Verlage (die viele in „vorauseilendem Gehorsam“ selbst besorgten) war es ›offiziell‹ nicht mehr ihres, man hatte sie schlechterdings enteignet. Der Verlag vertrieb das Buch ab 1938 unter
dem Autorennamen Rudolf Rösch (angeblich ein Küchenmeister), womit es zu einem „arischen“ Werk umgewandelt war. Eine – für diesen wie auch für andere Sachbuch- bzw Wissenschaftsverlage
– probate und lukrative Lösung, schließlich gehörten „Sachbücher ... zu den erfolgreichsten Buchtypen im Dritten Reich“, wie Karina Urbach den Historiker Christian Adam zitiert.
Man betrog die Verfasserin also um Geld, das ihr zugestanden hätte. Aber nicht allein das – man raubte ihr, indem man sie nicht mehr als Urheberin ihres eigenen Werks
anerkannte, ihr geistiges Eigentum. Alice Urbach war das schmerzlich bewusst. Sie hat, nach 1945, Versuche unternommen, diese Anerkennung zurückzuerlangen, ihre Nachfahren haben später weitere Anstrengungen unternommen,
übrigens ohne dieselben je mit finanziellen Forderungen zu verknüpfen. Sie blieben erfolglos. Und damit, schreibt die Enkelin, „begann die wahre Schuld des Hermann Jungck“ (seit 1937 im Verlag Nachfolger
von Ernst Reinhardt). Jungck weigerte sich späterhin nicht nur, Alice Urbach ihre Rechte zurückzugeben, er diskreditierte sie bzw die Qualität der Ursprungsveröffentlichung sogar noch, um sein Tun zu rechtfertigen.
Seine Nachfahren im Verlag halten es nicht anders.
Was Karina Urbach zu diesen Vorgängen recherchiert und was sie dazu berichtet, liest sich wie ein Krimi. Und es ist ja de facto auch einer. Alice Urbachs ›Fall‹
ist aber kein Einzelfall. Wie sie als Autorin bestohlen wurde, so wurden noch viele andere (Sachbuch-)Autoren und Autorinnen bestohlen, auch davon berichtet Das Buch Alice. Dieses Unrecht reicht bis in unsere Gegenwart hinein,
Gerechtigkeit widerfuhr den Beraubten nicht, im Gegenteil: „Mit dem ... geistigen Diebstahl von Leistungen jüdischer Autoren und Herausgeber hat sich niemand beschäftigt. Es existiertz noch keine Statistik
über die ungefähre Zahl der Betroffenen. Das Thema kommt in der Forschung einfach nicht vor.“
Vielleicht, hoffentlich, ist Urbachs Buch auch ein Anfang dafür, dass sich das ändert.
Urbach, Karina: Das Buch Alice. Wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten. 2020 (2. Auflage), 420 S., Propyläen Verlag, 3-549-10008-6 / 978-3-549-10008-0,
EURO 25,00
* In einem Kapitel weist Urbach auf Ludwig Hirschfelds „längst vergessenen Reiseführer Wien - Was nicht im Baedeker steht“ hin. Ein in der Tat höchst interessanter und unterhaltsam-ironischer feuilletonistischer Reiseführer aus den 1920er-
Jahren durch die 1920er in Wien. Hirschfeld (Kolumnist) porträtiert und kommentiert mit spitzer Feder seine Stadt, ihre Eigenheiten, insonders die ihrer Bewohner, allein schon seiner pointierten Spöttereien wegen
lohnt die Lektüre. Und es gibt dieses ›längst vergessene‹ Buch noch.
Der bibliophil editierten, mit Originalzeichnungen von Adalbert Sipos und Leopold Gidö illustrierten Ausgabe, die aktuell im Milena Verlag vorliegt, ist ein Nachwort des in
Wien arbeitenden Reisejournalisten Martin Amanshauser angefügt. Er ordnet Hirschfelds Werk (auch anhand kritischer Betrachtungen) ein – und er beschreibt, wie die Nazis auch diesen jüdischen Autor verfolgten,
beraubten, schließlich mitsamt seiner Familie ermordeten.
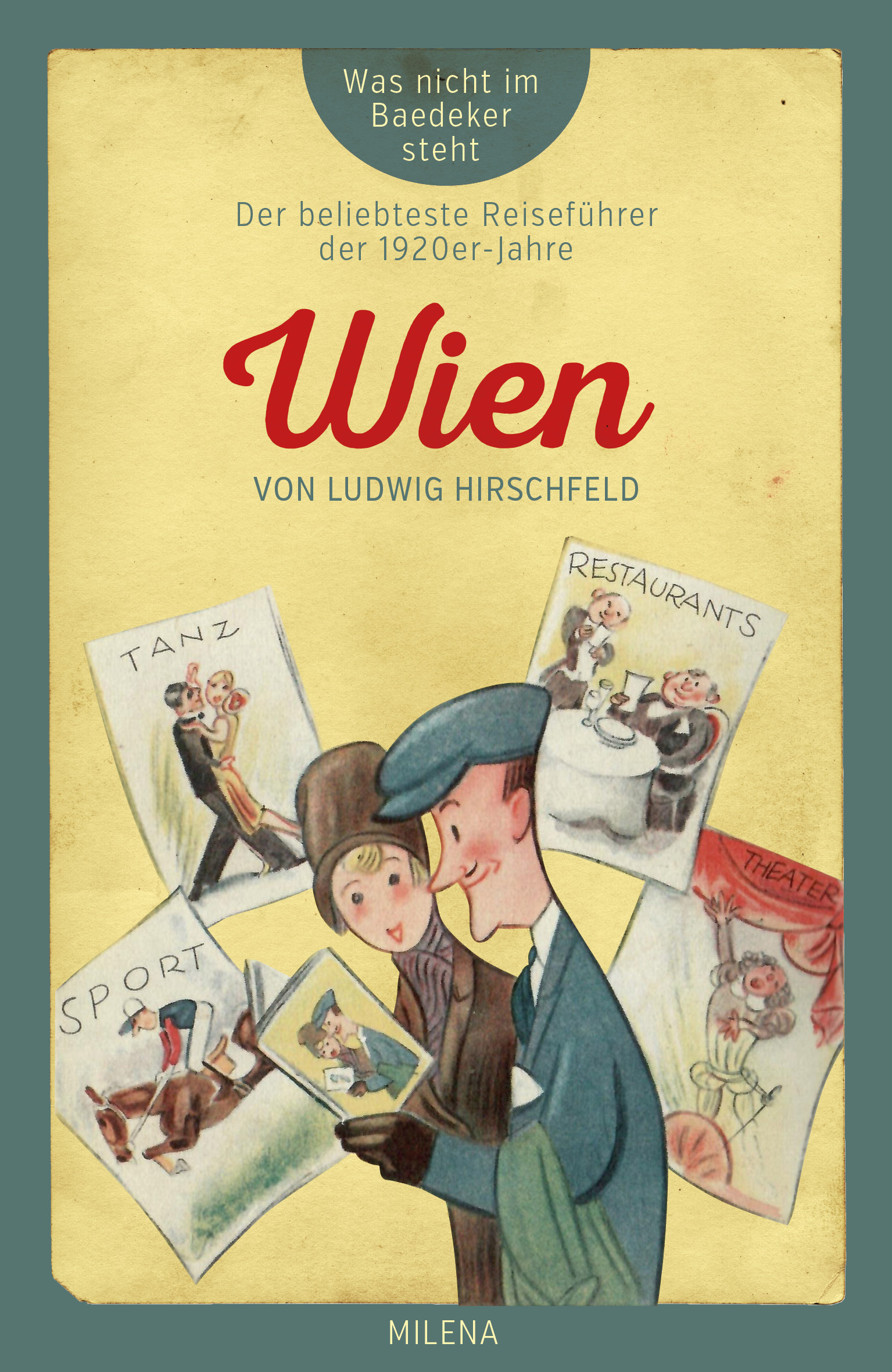
Hirschfeld, Ludwig: Wien – Was nicht im Baedeker steht. 2020, 256 S., 20 Abbildungen, Milena Verlag 3-903184-57-8 / 978-3-903184-57-2, EURO 23,00
© Gitta List
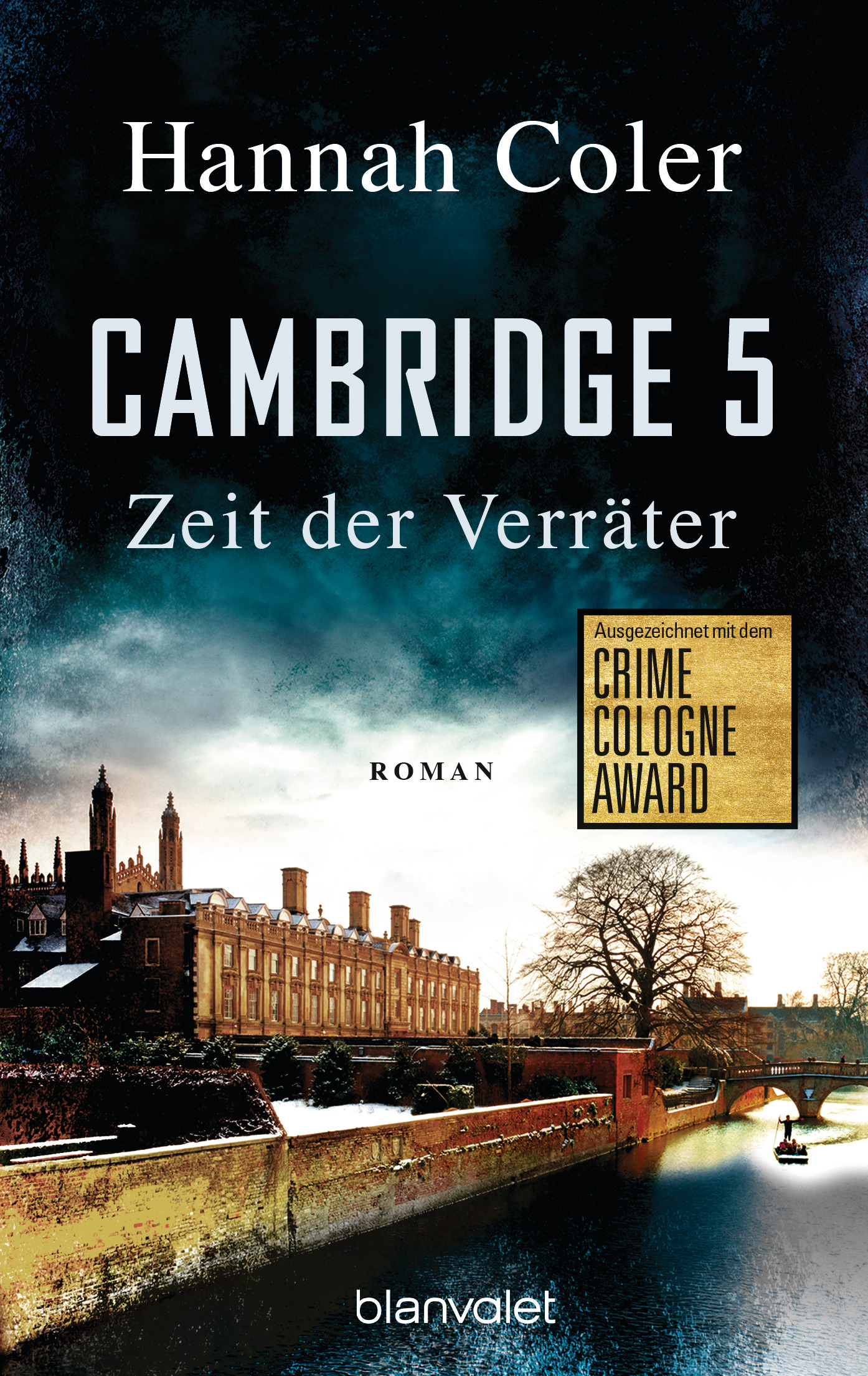
Coler, Hannah [d.i. Karina Urbach]: Cambridge 5 – Zeit der Verräter. Im Anhang: Nachwort / Anmerkungen / Quellen / Literaturverzeichnis (Auswahl),
--- 2017, 416 S., Limes Verlag, 3-8090-2682-4 / 978-3-8090-
2682-2, EURO 19,99
--- 2019, 416 S., Blanvalet Taschenbuch 0825, 3-7341-0825-X /
978-3-7341-0825-9, EURO 11,00
Cambridge ist ein Ort der Spione. Hier werden Freundschaften geschlossen und verraten. Geschichtsprofessor Hunt weiß das nur zu gut, vielleicht interessiert er sich
deshalb so für die Promotion der deutschen Studentin Wera, die fasziniert ist von der Spionagegruppe der „Cambridge 5“: Fünf Studenten, die sich in den 1930er-Jahren vom russischen Geheimdienst anheuern
ließen und jahrzehntelang erfolgreich Informationen weitergaben. Diese Zeiten scheinen lange vergangen. Doch dann wird Hunt in einen Mordfall verwickelt. Hat er etwas zu verbergen, oder will man ihm die Schuld zuschieben?
Und welche Rolle spielt Wera wirklich? Die Zeit der Spione ist anscheinend noch lange nicht vorbei. … Bis heute ist die Universität von Cambridge ein Ort der Geheimdienste. Die berühmtesten Spione des 20. Jahrhunderts
wurden in Cambridge rekrutiert wie z.B. die Cambridge 5: Söhne aus bestem Hause, die in den 1930er-Jahren in Cambridge studierten und hier für den Kommunismus begeistert wurden. Offiziell arbeiteten sie für
den britischen Geheimdienst, tatsächlich verrieten sie alle Operationen nach Moskau und schickten damit unzählige westliche Agenten in den Tod. Frauen haben dabei immer eine wichtige Rolle gespielt: Bei den Cambridge
5 waren es die Ehefrauen, die für Moskau arbeiteten, heute setzen Geheimdienste gerne Frauen für Agentendienste ein. Niemand wird leichter übersehen als eine unscheinbare Frau.
Hannah Coler ist das Pseudonym einer deutschen Historikerin. Sie studierte Geschichte in Cambridge und lehrte an deutschen und britischen
Universitäten. Hannah Coler war an zahlreichen Dokumentationen des ZDFs und der BBC beteiligt. Seit 2015 lebt sie mit ihrer Familie in der Nähe von New York. „Cambridge 5 – Zeit der Verräter“
ist ihr erster Roman. Die Jury der Autorengruppe deutschsprachige Kriminalliteratur, „Das Syndikat“, hat Hannah Coler mit ihrem Kriminalroman „Cambrigde 5 – Zeit der Verräter“ für den
„Friedrich-Glauser-Preis 2018“ in der Sparte Debüt nominiert. Ebenfalls 2018 wurde Hannah Coler mit dem „Crime Cologne Award“ für ihren Roman „Cabridge 5 – Zeit der Verräter“
ausgezeichnet. (vt/tp)
--- „8 Fragen an Hannah Coler“ siehe KTP 126
|
|
Menschen Viren Viderlinge
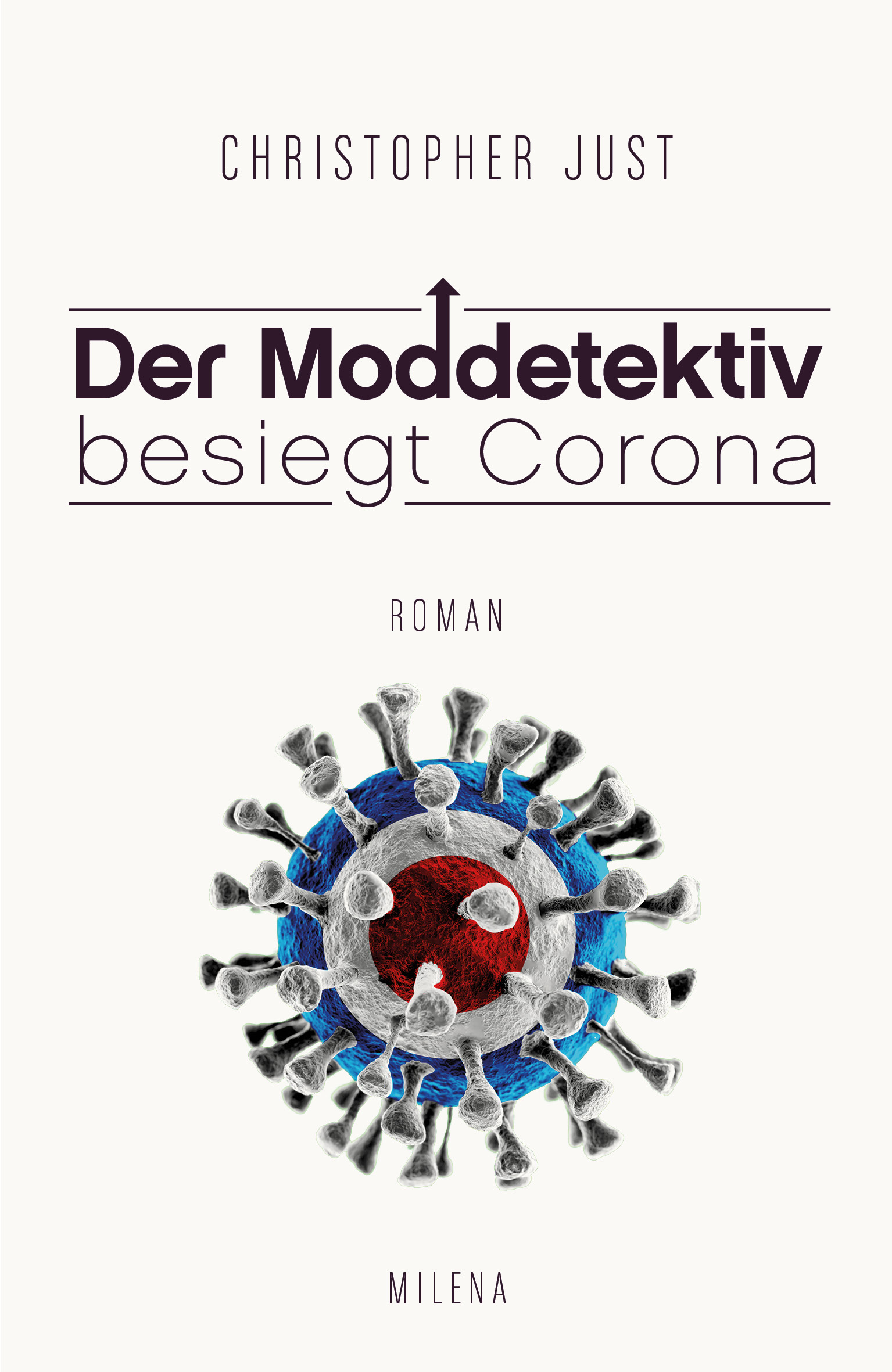
»... wie ernsthaftes Verhalten die Tarnung des Trottels ist, ist Narrheit in ihren exquisiten Arten von Belanglosigkeit und Gleichgültigkeit und Mangel an
Sorge das Gewand des weisen Mannes. In solch einem geschmacklosen Zeitalter wie diesem brauchen wir alle Masken.« Oscar Wilde
Sein Parka ist ein M51 (was sonst), seine Vespa GS hat 16 Rückspiegel und 12 Scheinwerfer, sein jeansblauer Blick© hat mindestens 13000 Volt, es sei denn, die Purple
Hearts sind gerade out of stock. Er ist Augustin »Gustl« Johnny Sandemann. Und: Er ist Der Moddetektiv*.
Der coolste, bestfrisierte, ausgebuffteste unter allen (Wiener) Privatermittlern, der größte Dandy unter allen ernsthaft praktizierenden Mods, der exzentrischste aller
Exzentriker.
(*Sie kennen ihn aus dem Roman Der Moddetektiv. Etwa nicht? Wie bedauerlich für Sie.)
Der Moddetektiv hat schlechte Laune: Seine Purple Hearts gehen zur Neige, aber »der Zeleni«, sein »treuloser Tablettentrödler«, geht einfach nicht
ans Telefon. Außerdem benötigt sein Original French Cut dringend frisches Fasson, aber dem Haarstylisten seines Vertrauens sind leider infolge des zweiten Corona-Lockdowns die Hände gebunden. Das alles zermürbt
natürlich: »Die allerschlimmsten Auswüchse dieser scheißverdammten Hurendrecksseuche waren eindeutig die frisürlichen.«
Noch viel unschöner: »Die Birgit« wurde entführt, des Moddetektiv »Ein und Alles«, »zweite größte Liebe seines Lebens, die er
indes einst zu lange warten ließ (weil er nun einmal der Moddetektiv und also ein lonesome player ist), worauf sie sich von ihm getrennt und »dem aufstrebenden Jungschauspieler« zugewandt hat (selbstverständlich ohne den Moddetektiv je vergessen zu können). Hinter der Tat steckt
der elegante Finsterling Coronald Covidel (tatsächlicher Name: Frauko Ludwig), der nach nichts Geringerem strebt als nach der Weltherrschaft. Zu diesem Zweck hat er sich erstens eine Schar »gutgläubiger Idioten«
gefügig gemacht und zu »Apokalyptischen Anniesern« dressiert. Deren Waffe steckt, man ahnt es, in ihnen selbst, sie sind quasi der Biokampfstoff, den er als Waffe einzusetzen gedenkt. Der Birgit soll zweitens
die Rolle zukommen, mit dem ihr zwangsvermählten Pan d’Emie (bürgerlicher Name: Massepain d’Emie) Covidels Superhero zu zeugen, den »ANTIMMUN«.
Wieder einmal muss der Moddetektiv alles geben, um die Welt zu retten – und seine Schöne.
Nur gut, dass auch die attraktive Tracy Contact (bipolar und Special Agent der CIA), der geniale Forensiker Thompson sowie Kiss-Frontman Paul Stanley mit von der Partie sind, Covidels
Plan zu vereiteln.
Christopher Just geht als Performer, Produzent und »Pionier der elektronischen Musikszene« seit je recht furchtlos vor, literarisch treibt er es nicht weniger kühn.
Der Wiener Standard bescheinigte seiner Prosa »tiefen Humor und schlechten Geschmack«, lobte seinen zweiten Roman (Catania Airport Club, 2017, um Serienmorde in der Modewelt) als »puren Trash, sehr lustig und gespickt mit Zitaten aus der Literatur- und Popgeschichte« und
zitierte in diesem Zusammenhang auch gleich genüsslich, was der Autor nach eigenem Bekunden von der Schreibtheorie der honorablen Kollegen Stephen King oder Elmore Leonard gelernt hat: »Die mögen keine Adjektive
und Wie-Vergleiche. Das hat mir getaugt. Ich hab meinen Roman gleich damit vollgestopft.«
Just huldigt dem Trash geradezu, pfeift auf jegliche Dezenz, stilistisch, inhaltlich – und es ist schlichtweg hinreißend, wie formvollendet er das tut. Er ist ein Akrobat
der Alliteration (»der Moddetektiv sah sauer auf seine silberne Seiko«) und der Übertreibung, treibt Wortspielereien unverzagt auf die Spitze (und darüber hinaus). Und auch in ... besiegt Corona plündert er sich wieder mit Aplomb und Ironie durch diverse Klassiker des Spannungsgenres (von Das Schweigen der Lämmer über Inspector Columbo bis Die Hard – und Biblisches kommt auch drin vor). So geht Trash auf höchstem Niveau: elegant, witzig und sehr spannend.
Dass es sich dabei zudem um Qualitätssatire handelt (auf das aktuelle Geschehen wie auf den desolaten Zustand der Menschheit überhaupt): Versteht sich.
Just, Christopher: Der Moddetektiv besiegt Corona. 2020, 384 S., Milena Verlag, 3-903184-58-6 / 978-3-903184-58-9, EURO 23,00
© Gitta List
|
Die Beiträger/innen
Martin Compart Geboren 1954 in Witten. Studium der Politologie. Damals auch Mitbegründer der
Arbeitsgemeinschaft Kriminalliteratur. Herausgeber der gelben Krimi-Reihe, Populäre Kultur und Ullstein-Abenteuer; Herausgeber der Schwarzen Serie, Thriller, Polit-Thriller bei Bastei-Lübbe; Herausgeber Dumont Noir
und Teilhaber beim Strange Verlag. Artikel für zahlreiche Zeitschriften, daneben Radio-Features und TV-Produktionen. Zehn Jahre Mitglied in der Grimme-Jury. Teilhaber des Zerberus Verlages und Betreiber mehrerer Blogs.
https://martincompart.wordpress.com/
Jim Madison Davis is Professor Emeritus of Professional Writing at the University of Oklahoma. He is the author of eight novels, including „The Murder of Frau Schütz“, an Edgar nominee,
„Law and Order: Dead Line“ and „The Van Gogh Conspiracy“. He has also published seven nonfiction books, and dozens of short stories and articles. He is a columnist on international crime writing for
„World Literature Today“ and North American President of the International Association of Crime Writers. He lives in Palmyra, Virginia (USA).
Gitta List, Jahrgang 1959, ist Literaturwissenschaftlerin und lebt in Bonn. Sie leitet die Redaktion
des Bonner Stadtmagazins „Schnüss“ und publiziert seit vielen Jahren zum Thema Kriminalliteratur.
Alfred Miersch (webmaster), geboren 1951, gelernter Verlagskaufmann. Langjährige Beschäftigung mitder Literatur. 1975-1979 war er Herausgeber des Literaturmagazins „Tja“, das in der alternativen Literaturszene
als Geheimtipp galt. 1980 gab er einmalig die Zeitschrift „Omnibus“ heraus, als Versuch einer zeitgemäßen Anthologie mit Autoren wie Uli Becker, F.C. Delius, Joe Brainard u.a. Seit 1980 schrieb er eigene
Bücher und beteiligte sich mit Prosa und Lyrik an über 40 Anthologien bei Rowohlt, S. Fischer, Kiepenheuer & Witsch, dtv, Maro und Schirmer/Mosel. Im September 2000 gründete er den NordPark-Verlag. Über
lange Jahre zeichnete er veranwortlich für das legendäre Online-Krimiportal „Alligatorpapiere“. Alfred Miersch wurde vielfach ausgezeichnet: 1981, Kulturpreis Wuppertaler Bürger / 1982, Hungertuchpreis
der Stadt Frankfurt / 1984, 1. Lyrikpreis beim 4. Nordrhein-Westfälischen Autorentreffen / 1984, Förderpreis Literatur des Landes NRW / 1997, 2. Krimipreis beim 10. NRW Autorentreffen / 2004, Friedrich-Glauser-Preis
– Krimipreis der Autoren in der Sparte „Ehrenglauser“ für seine Verdienste um die Kriminalliteratur im deutschen Sprachraum.
www.nordpark-verlag.de/miersch
Ingrid Przybilka, Jahrgang 1948, kritische und kompetente Schlussredaktion. Hierfür sei ihr herzlich
gedankt.
Thomas Przybilka (tp), geboren 1950, lebt und arbeitet als Buchhändler in Bonn. Gründete 1989 das „Bonner Krimi Archiv Sekundärliteratur“ (BoKAS), zahlreiche Publikationen zur Kriminalliteratur
(Bücher und Artikel) im In- und Ausland. [Zuletzt: Bernhard Jauman – Eine Auswahlbibliographie der Sekundärliteratur. In: Erb, Andreas (Hg): Bernhard Jaumann: Tatorte und Schreibräume – Spurensicherungen.
2015, Aisthesis Verlag]. Mitglied u.a. in der Autorengruppe deutschsprachige Kriminalliteratur „Das Syndikat“. Mitherausgeber der „Alligatorpapiere. Magazin zur Kriminalliteratur“. 2012 wurde ihm „In
Würdigung seines Engagements für die deutschsprachige Kriminalliteratur und für sein bisheriges literarisches Gesamtwerk im Bereich Kriminalliteratur“ der „Friedrich-Glauser-Preis – Krimipreis
der Autoren 2012“ in der Sparte „Ehrenglauser“ von der Jury der Autorengruppe deutschsprachige Kriminalliteratur „Das Syndikat“ zuerkannt.
www.bokas.de
www.das-syndikat.com/autoren/autor/120-thomas-przybilka.html
www.krimilexikon.de/przybilk.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lE9RJQ7QXp4
Katya Skow grew up in a family of mystery lovers. Among her first loves were Agatha Christie, Georges
Simenon, and John D. McDonald, probably in about that order. As a child she lived in a small town in Austria for two years and there learned to communicate with her classmates and teachers. Later, at Middlebury College in
Vermont, she studied German. She next attended graduate school in Germanic languages and literatures at the University of Illinois at Urbana-Champaign where she trained as a medievalist, writing her dissertation on Die sieben weisen Meister under the guidance of Dr. Marianne Kalinke. She has published articles on medieval and late-medieval topics, but now works on more modern popular
fiction. She is Professor of German at The Citadel, The Military University of South Carolina (USA).
http://www.citadel.edu
http://www.citadel.edu/root/mlng-faculty-staff/59-academics/schools/shss/modern-languages-literatures-a-cultures/21879-dr-katya-skow
|
(tp) = © Thomas Przybilka
(vt) = Verlagstext
Inhalt = Verlagstext
Bezugshinweis
Unterstützen Sie bitte Ihren Buchhändler vor Ort – er wird sich über Ihre Bestellung freuen. Denken Sie daran: Amazon ist keine Buchhandlung, sondern
ein Gemischtwarenladen!
Sie erhalten den e-mail-newsletter „Krimi-Tipp Sekundärliteratur“ (KTS) aufgrund Ihrer persönlichen und schriftlichen Anforderung.
Folgende Daten von Ihnen sind im Verteiler für den KTS ge-speichert:
--- Vorname
--- Nachname
--- E-Mail-Adresse
Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben!
Der „Krimi-Tipp Sekundärliteratur“ (KTS) ist jederzeit kündbar / Unsubscribe: crimepy@t-online.de
|
| |